„Die unbewohnbare Erde“ von David Wallace-Wells
Ein intensiver wie spannender Report über neue und leider immer noch allzu akute Perspektiven auf den Klimawandel
Man mag es angesichts der erdrückenden Last wissenschaftlicher Erkenntnis nicht glauben, wie verzagt die Menschheit trotz aller Selbstbeschwörungen und Ankündigungen auf zig Gipfeln nach wie vor agiert, wenn es um nichts weniger als die Rettung unseres Planeten geht. Vor diesem Hintergrund ist es kein Wunder, dass ein vielfach diskutabler Film wie Adam McKays Asteroidenapokalypse „Don’t Look Up“ vielleicht zu dem Werk dieser Dekade werden könnte, in dem genau die Missachtung der Wissenschaft trotz buchstäblich sichtbarer Auswirkungen den finalen Sargnagel der Menschheit markiert.
Wer nicht blind durchs Leben geht oder eben schon ein paar Semester auf dem Buckel hat, weiß natürlich nur zu gut, dass die Mahnungen der Klimaforschung schon seit Jahrzehnten auch durch die Popkultur wabern und man sich immer nur darüber wundern kann, mit welcher Mischung aus Zustimmung und gleichzeitiger Ignoranz Al Gore und Co. schon einst beklatscht wurden. Was hat sich seither denn wirklich getan?
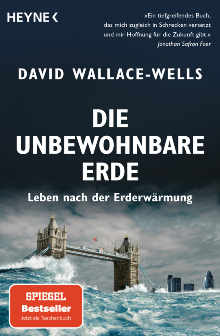 Die Debatte um die Folgen der Erderwärmung ist also beileibe nicht neu, steckt jedoch trotz zahlreicher Bücher zum Thema von Jonathan Safran-Foer bis Maja Göpel gefühlt ein wenig fest. Sind wir alle schuld oder doch „nur“ der globale Kapitalismus und eine zu zögerliche Politik? Bringt es überhaupt noch etwas, sich individuell zu bemühen oder ist dieses Abwälzen auf uns „Verbraucher“ letztlich ebenfalls ein Marketingtrick, der von den wirklich relevanten Lösungen ablenkt? Und was ist mit all denen, die dennoch immer noch nicht an eine Klimakrise glauben wollen und die längst greifbaren neuen Normalitäten unserer Umwelt zwischen Bränden, Stürmen, Hochwasser und Artensterben ignorieren?
Die Debatte um die Folgen der Erderwärmung ist also beileibe nicht neu, steckt jedoch trotz zahlreicher Bücher zum Thema von Jonathan Safran-Foer bis Maja Göpel gefühlt ein wenig fest. Sind wir alle schuld oder doch „nur“ der globale Kapitalismus und eine zu zögerliche Politik? Bringt es überhaupt noch etwas, sich individuell zu bemühen oder ist dieses Abwälzen auf uns „Verbraucher“ letztlich ebenfalls ein Marketingtrick, der von den wirklich relevanten Lösungen ablenkt? Und was ist mit all denen, die dennoch immer noch nicht an eine Klimakrise glauben wollen und die längst greifbaren neuen Normalitäten unserer Umwelt zwischen Bränden, Stürmen, Hochwasser und Artensterben ignorieren?
Man muss wohl zugestehen, dass gerade letzteres Problem auch durch David Wallace-Wells und dessen extrem aufrüttelnde Reportage „Die unbewohnbare Erde“ (im Shop) nicht gelöst werden kann. Wer sich von Zukunftskrisen erdrückt fühlt oder sie nicht sehen will, wird erst gar nicht zu diesem Buch greifen, das nach seiner Erstveröffentlichung 2019 nun in einer erweiterten Taschenbuch-Ausgabe auf Deutsch erschienen ist. Was der engagierte Journalist allerdings mit seiner weltweit anerkannten und von einer akribischen Auswertung wissenschaftlicher Expertise geführten Arbeit leistet, ist jedoch nichts weniger als der im Sachbuchbereich vielleicht weitreichendste, aber eben auch realistische Ausblick in die Zukunft.
Hervorragend recherchierte Felder wie Hunger, Wirtschaft, Hochwasser oder der Kollaps ganzer Systeme werden in „Die unbewohnbare Erde“ eng verschaltet mit Gedanken zu unserem Umgang mit der Klimakrise und ihren Begleiterscheinungen. Wallace-Wells erhebt sich allerdings, ähnlich wie Safran-Foer in „Wir sind das Klima!“, eben nicht über diejenigen, die dem Thema wenig oder zu einseitig Beachtung geschenkt haben, und gibt selbst unumwunden zu, nicht einmal ein großer Freund der Natur oder des Fleischverzichts zu sein. Aber genau diese Position können wir uns längst nicht mehr leisten, da die Auswirkungen des Klimawandels längst in unser aller Alltag angekommen sind.
Doch es geht in „Die unbewohnbare Erde“ nicht um Empathie oder Anklage, denn das Buch arbeitet sich vor allem an der Frage ab, inwieweit wir eben bereits heute die Folgen des Klimawandels an zahlreichen Stellen unseres Lebens zwischen Gesundheit, Konsum und Wohnen hautnah spüren und welche konkreten Folgen unser (Nicht-)Handeln für die Jahre bis 2100 hat. Beeindruckend ist dabei vor allem die Klarheit der Betrachtung und Auswertung, mit der verdeutlicht wird, wie radikal sich unser aller Existenz durch Klimaflüchtlinge, Ressourcenknappheit und reduzierte Lebensräume verändern wird. Dabei tendiert Wallace-Wells trotz erdrückender Anschaulichkeit seiner Analysen aber nicht zur Resignation, sondern plädiert immer wieder dafür, die Realität zu akzeptieren und daraus ein Handeln abzuleiten, das uns hilft, in der neuen Realität einer stark erwärmten Erde mit noch mehr Umweltkatastrophen weiterzuleben.
Am stärksten ist das Buch aber gerade in den Kapiteln, in denen es sich am deutlichsten von vergleichbaren Auseinandersetzungen mit dem Thema abhebt, in denen ausschließlich über den Stand der Forschung referiert wird. So hinterfragt Wallace-Wells eben auch gesellschaftliche Erzählungen bzw. Meta-Narrative wie das wirtschaftsliberale Versprechen von steigendem Wohlstand und einer Lösung aller Probleme mithilfe von Technologie mit einer bestechenden Schärfe und fordert eine reflektierte Bestandsaufnahme über die Entstehung und Folgen solcher Narrative – auch über Wirtschaft und Politik hinaus.
Wie sehr sich der Autor dennoch seine Zuversicht bewahrt hat, obwohl er ständig die Aussichtslosigkeit einer vollständigen Abwendung der Krise betont, ist wahrscheinlich die persönlich verblüffendste Leistung, die sich in den weit über 300 Seiten widerspiegelt. Ein Punkt, den man mit Blick auf das Thema nicht unbedingt mehr erwarten könnte bei jemandem, der sich so tief in die teils doch sehr düstere Welt der Zukunftsprognostik mit all ihren notwendigen Anpassungen und prognostizierten Todeszahlen vergräbt. Es bleibt bei aller Aggressivität der Fakten ein Funken Hoffnung – ein Narrativ, das man zwar ebenfalls hinterfragen, aber nach Lektüre dieses im besten Sinne visionären Buches dann doch irgendwie wieder glaubhafter empfindet. Denn immerhin, wir bewegen uns. Wenn auch zu langsam.
David Wallace-Wells: Die unbewohnbare Erde • Sachbuch • Übersetzt von Elisabeth Schmalen • Wilhelm Heyne Verlag, München 2022 • 368 Seiten • Erhältlich als Paperback, Taschenbuch und eBook • Preis des Taschenbuchs: € 11,00 • im Shop



Kommentare