Die Zukunft des Reisens
Eine Leseprobe aus Tal. M. Kleins Science-Fiction-Debüt „Der Zwillingseffekt“
Der öffentliche Nahverkehr hat seine Tücken, das wurde in den vergangenen Wochen mehr als deutlich. Wer träumt sich inmitten von S-Bahn-Chaos und Zugausfällen nicht manchmal in eine Welt, in der man sich à la Captain Kirk einfach an seinen Zielort beamen lassen könnte. Wie so eine Welt aussehen könnte und dass die Teleportation auch nicht gerade die ungefährlichste Art des Reisens ist, zeigt uns Tal M. Klein in seinem genialen Debüt „Der Zwillingseffekt“ (im Shop). Der Roman erscheint am 10.04.2018 auf Deutsch, und einen ersten Einblick in die Zukunft des Reisens finden Sie hier.
Annähernd unendlich
ICH WACHTE AUF MEINER COUCH AUF.
Schnell checkte ich mein Kom und stellte fest, dass es 21:12 Uhr am 27. Juni 2147 war. Scheiße. Es war unser zehnter Hochzeitstag, und Sylvia und ich hatten geplant, uns um halb zehn in unserer alten College-Lieblingsbar zu treffen. Ich war beim Videospielen eingedöst, was für einen Abend unter der Woche nicht ungewöhnlich war. Normalerweise spielte es keine Rolle, da Sylvia nicht vor Mitternacht nach Hause kam, aber selbst mir war klar, dass es keine nette Geste war, sich zur Aluminiumhochzeit zu verspäten.
Ich sprang von der Couch auf und wischte mit einer Handbewegung mehrere offene Spielefenster auf meinem Kom beiseite. Falls Sie sich in der Zukunft alle telepathisch verständigen oder so, ein Kom ist ein neurales Implantat, das praktisch jeder an seinem zweiten Geburtstag erhält. Das Ganze ist ein Hybridnetz aus Nervenstammzellen und Naniten, das von unserem Körper wie ein gutartiger Tumor behandelt wird und mit dem Hör- und Sehzentrum unseres Gehirns verknüpft ist. Auf diese Weise wird die Wahrnehmung unserer Ohren und Augen durch Audio- und Videodaten erweitert. Als Kom bezeichnen wir außerdem jede Fernkommunikation. Wir haben so viele Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren, dass wir einfach jede virtuelle Unterhaltung mit jemand anderem als Kom bezeichnen – und ja, manchmal ist es verwirrend, wenn wir eine Kom auf unserem Kom empfangen.
Die Videospiele verschwanden und erlaubten mir einen relativ unverstellten Blick auf mein ziemlich zugestelltes Apartment. Sylvia und ich hatten eine nette Drei-Zimmer-Eigentumswohnung in Greenwich Village – frei liegende Ziegel und Stahlträger, hübsch gefurchte Hartholzböden, drei Meter hohe Fenster mit Blick auf die Houston Street. In diesem Moment ignorierte ich das alles und marschierte zügig zum Schrank des Hauptschlafzimmers, wo ich nach einem einigermaßen sauberen Hemd suchte, das ich über mein T-Shirt mit der Aufschrift WAS WÜRDE TURING TUN? ziehen konnte.
Während ich knöpfte und stopfte, verfluchte ich mich stumm dafür, dass ich kein Wecksignal aktiviert hatte. Nun gut, unsere Ehe war während des vergangenen Jahres tendenziell auf dem absteigenden Ast gewesen, aber ich wollte jetzt auf keinen Fall den Anlass für das »große Gespräch« geben. Und fairerweise musste man sagen, dass wir beide die Schuld am Niedergang unserer Beziehung trugen.
Sylvia war vor fast acht Jahren von International Transport – IT – angestellt worden. Sie war Quantenmikroskoptechnikerin, ein Fachgebiet, das ich nur sehr oberflächlich gegrokt hatte, und sie hatte sich fleißig in der Nahrungskette des Unternehmensmegalithen nach oben gearbeitet. Vor etwa einem Jahr war sie in eine neue, streng geheime Position befördert worden. Sie hatte mich gewarnt, dass es erheblich mehr Zeit im Büro bedeutete, aber der Einkommenssprung hatte es uns gleichzeitig ermöglicht, von unserer Zwei-Zimmerchen-Wohnung in der Vorstadt auf North Brother Island in die Innenstadt umzuziehen. Damals war es uns wie ein verspätetes Geburtstagsgeschenk der Götter vorgekommen. Doch während die Monate verstrichen, sahen wir uns immer seltener, und Sylvias neuer Job schien eher Fluch als Segen zu sein.
Erneut checkte ich mein Kom: 21:21 Uhr. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich würde es auf gar keinen Fall rechtzeitig ins Mandolin schaffen, selbst wenn ich ein Auto nahm. Ich musste
hinteleportieren. Um die kurzfristige Prasserei zu vertuschen, entschied ich, einen Salting-Job anzunehmen.
Mit Salting verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Das bedeutet nicht, dass ich meine Tage damit zubringe, Salz aus alten Gewässersedimenten zu ernten, auch wenn das ähnlich aufregend klingt. Die Aufgabe eines Salters ist es, verschiedene Künstliche Intelligenzen zu bereichern. Ich könnte mir vorstellen, dass Salting in Ihrer Zeit genauso ausgestorben sein wird wie der Beruf des Flussschiffkapitäns, des Chauffeurs oder des Lehrers, weil wir auf jede erdenkliche Weise durch Apps übertroffen und ersetzt wurden.
Aber in meiner Gegenwart gab es immer noch ein fundamentales Problem mit der Denkweise von Computern. Ohne jetzt zu fachlich zu werden – dabei ging es um etwas, das mit dem deutschen Begriff »Entscheidungsproblem« bezeichnet wird. Versuchen Sie mal, das dreimal ganz schnell hintereinander zu sagen (vor allem, wenn Sie kein Deutsch können).
Aufgrund des Entscheidungsproblems können Computer keine eigenständigen Entscheidungen treffen. Bei jeder Entscheidungsfindung können sie nur von vorprogrammierten Daten und Algorithmen ausgehen. Das soll nicht heißen, dass Computer keine neuen Ideen entwickeln können, aber das geht nur, indem sie alte Ideen neu aufbereiten, oder durch externen Input von anderen Computern oder von Menschen – und an dieser Stelle komme ich ins Spiel.
Wir Salter verbringen unsere Tage damit, uns beliebige Rätsel einfallen zu lassen, die eine KI-Engine nicht groken kann. Jedes Mal, wenn das Gambit eines Salters von einer App nicht vorhergesehen war, wurde diese App intelligenter, indem sie diese unvorhergesehenen Zufallselemente ihrem Entscheidungsalgorithmus hinzufügte, und der Salter wurde bezahlt. Im Wesentlichen verdiente ich mein Geld, indem ich für die Apps den Klugscheißer spielte. In meinem Metier orientierte sich der Aufstieg innerhalb der Hierarchie an der Qualität der akzeptierten Salting-Jobs. Die Mine, für die wir arbeiteten, verfolgte unsere Akzeptanzquote auf einer öffentlichen Bestenliste. Je besser die Quote, desto begehrenswerter war man und desto mehr Kohle scheffelte man. Die meisten Salter verstanden den feinen Unterschied nicht,ob man für eine App ein Klugscheißer oder ein Idiot war, also neigten sie dazu, härter und länger zu arbeiten, um ein passables Einkommen zu erzielen. Wenn man berücksichtigte, dass ich von Natur aus faul war, kam ich ganz gut zurecht. Ich hatte eine Methode gefunden, die Kunst des Saltings in eine reproduzierbare Formel aus Menschlichkeit, Komplexität und Humor zu destillieren. Definitiv bin ich nicht der beste Salter aller Zeiten, aber in der weltweiten Bestenliste bewegte ich mich beständig unter den obersten fünf Prozent.
»Machst du heute schon deinen zweiten Job?«, begrüßte mich Adina, die Admin, nachdem ich mich eingeloggt hatte. »Seit wann bist du zum Workaholic geworden?«
»Was soll ich sagen? Ich liebe meine Arbeit«, erwiderte ich, während ich mir meine elegantesten Sneakers anzog. »Eigentlich bin ich mit einem Termin spät dran und brauchedas Geld für ein Port-Ticket.«
»Eine Dose Mitleid für dich«, sagte Adina. »Wie auch immer, ich habe was Einfaches. Wieder jemand, der lernen will, witzig zu sein.«
»Ach Gott, wann lernen unsere Robotherrscher endlich, dass das einzig Witzige an ihnen ihre absolute Humorlosigkeit ist? Schieß es rüber.«
»Schon erledigt. Bis dann, Superhirn.« Adina lachte, als sie die Verbindung unterbrach.
»Hallo«, sagte eine nervöse Stimme. »Nur damit das klar ist: Ich bin ein er und kein es.«
Auf meinem Kom-Stream konnte ich nicht mehr sehen als einen schwarzen Kasten. »Wenn du nicht möchtest, dass die Leute dich als es bezeichnen, solltest du dir einen Avatar zulegen.«
»Ist das eine notwendige Voraussetzung?«, fragte er erwartungsvoll.
»Um witzig zu sein?«
Ein Grünschnabel. Leicht verdientes Geld!
»Nein. Hör mal, ich hab es ein bisschen eilig. Machen wir etwas Elementares. Wann lebte Gottlieb von Bouillon?«
Mein Hund, ein dreizehn Jahre alter portugiesischer Wasserköter, blickte von der Matte vor der Eingangstür auf, wo er es sich bequem gemacht hatte. Für viele Menschen hatten digitale Assistenten ein Haustier ersetzt. Sie waren leichter sauber zu halten, und sie lebten ewig. Vielleicht lag es an meinem Beruf, aber ich war immer ein Hundetyp geblieben. Ich ging in die Knie und zog vorsichtig die Matte, auf der sich der alte Knabe ausgebreitet hatte, von der Tür weg. Einmal Bauch kraulen, dann verließ ich mein Apartment und ging zum Treppenhaus, während ich mein Kom auf den oberen rechten Quadranten meines Sichtfeldes minimierte, damit ich nicht stolperte und zu Tode kam.
»Ich vermute«, sagte die App nach kurzem Zögern, »du fragst nach Gottfried von Bouillon. Er wurde um 1060 geboren und starb im Jahr 1100 in Jerusalem.«
»Deine Aussage ist korrekt. Aber sie ist keine Antwort auf meine Frage.«
»Aufgrund der Namensähnlichkeit bin ich davon ausgegangen, dass du Gottfried und Gottlieb verwechselt hast. Menschen machen häufig solche Fehler.«
»Auch das ist richtig. Aber nun beantworte bitte meine Frage: Wann lebte Gottlieb von Bouillon?«
»Eine Suche in den mir zugänglichen Datenbanken ergibt keinen Treffer für ›Gottlieb von Bouillon‹. Falls eine solche Person tatsächlich existiert hat, wurden ihre Lebensdaten nicht dokumentiert.«
»Das mag sein. Trotzdem ist es möglich, eine Antwort auf meine Frage zu geben.«
»Ich fürchte, mit den mir zur Verfügung stehenden Informationen lässt sich diese Frage nicht beantworten.«
»Bereit für den Money Shot?«
»Was ist ein Money Shot?«
»Das ist das, was passiert, wenn ich dich salte und du mich bezahlst.«
»Ach so. Dafür bin ich bereit. Genau das ist der eigentliche Sinn dieser Interaktion.«
Diese arme App muss von einem blutigen Anfänger kompiliert worden sein.
»Gut. Also verrate ich dir jetzt, wann Gottlieb von Bouillon lebte. Immer dann, wenn er nichts anderes zu essen hatte.«
»Sehr clever«, sagte die App emotionslos. »Salt bewilligt.«
Ich nahm mir vor, meinem Hund ein paar Leckerlis extra zu geben, wenn ich wieder zu Hause war.
»Eine andere mögliche Antwort auf meine Frage wäre ›Nie‹.«
»Weil ein Gottlieb von Bouillon nie existiert hat? Oder weil ein bestimmter Gottlieb nie von Bouillon gelebt hat?«
»Sehr nahe dran. Mein Hund heißt Gottlieb.«
»Ein ungewöhnlicher Name für einen Hund, aber nun verstehe ich. Weil dein Hund nur von Hundefutter und nie von Bouillon gelebt hat.«
»Richtig. Und warum heißt mein Hund Gottlieb?«
»Ungewöhnliche Hundenamen sind häufig von Prominenten abgeleitet. Vielleicht ein Schauspieler namens Gottlieb? Oder ein Programmierer oder Mathematiker?«
»Du denkst in eine völlig falsche Richtung. Mein Hund Gottlieb ist ein schwarzer Mischling aus Cockerspaniel und portugiesischem Wasserhund. Als meine Frau ihn zum ersten Mal als Welpe sah, rief sie aus: ›Ach Gott, wie lieb!‹ Also nannte ich ihn Gottlieb. Meiner Frau gefiel der Name gar nicht, aber es war schließlich mein Hund. Außerdem hatte sie selbst die Anregung geliefert. Habe ich mir damit eine Extraprämie verdient?«
»Ich fürchte, das rechtfertigt keine zusätzlichen Chits.«
»Gut. Bye.«
Ich schloss das Kom-Fenster, als ich gerade die Tür zur Straße aufdrückte. Es war nicht mein schnellster Geldjob, aber es war nahe dran. In den frühen Tagen der kognitiven Programmierung bezeichnete man es als neurolinguistisches Hacking, und darin war ich einer der Schnellsten an der Ostküste.
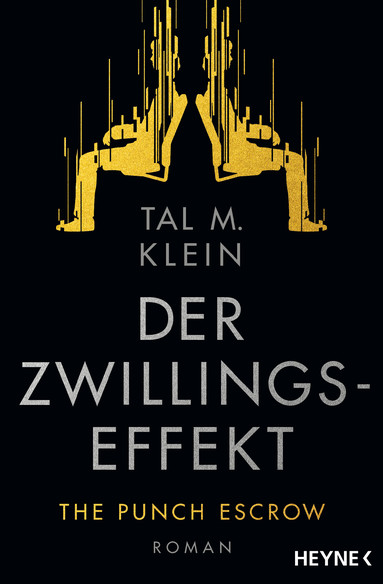 Nun gut, ich trug nicht gerade zur Verbesserung der menschlichen Lebensverhältnisse bei. Aber Ihnen ist sicher bewusst, dass viele Dinge, die früher »Arbeit« waren, schon vor langer Zeit von der Technik übernommen wurden. Klar, man konnte etwas mit eigenen Händen erschaffen, statt es sich ausdrucken zu lassen, und manche Menschen taten das immer noch gern. Allerdings war es wahnsinnig kostspielig im Vergleich zu den Alternativen – also wozu sich die Mühe machen? Die meisten Leute im Jahr 2147 verbrachten ihre Zeit damit, auf unterschiedliche Weise mit KI-Engines zu interagieren, um ihre Chits zu verdienen. Dabei hatten sie nur selten eine klare Vorstellung, für welches System sie gerade Probleme lösten oder zu welchem Zweck – sie wussten nur, dass sie davon ihre Rechnungen bezahlen konnten. Ich glaube, die meiste Zeit wollten die Apps nur jemanden, mit dem sie sich unterhalten konnten.
Nun gut, ich trug nicht gerade zur Verbesserung der menschlichen Lebensverhältnisse bei. Aber Ihnen ist sicher bewusst, dass viele Dinge, die früher »Arbeit« waren, schon vor langer Zeit von der Technik übernommen wurden. Klar, man konnte etwas mit eigenen Händen erschaffen, statt es sich ausdrucken zu lassen, und manche Menschen taten das immer noch gern. Allerdings war es wahnsinnig kostspielig im Vergleich zu den Alternativen – also wozu sich die Mühe machen? Die meisten Leute im Jahr 2147 verbrachten ihre Zeit damit, auf unterschiedliche Weise mit KI-Engines zu interagieren, um ihre Chits zu verdienen. Dabei hatten sie nur selten eine klare Vorstellung, für welches System sie gerade Probleme lösten oder zu welchem Zweck – sie wussten nur, dass sie davon ihre Rechnungen bezahlen konnten. Ich glaube, die meiste Zeit wollten die Apps nur jemanden, mit dem sie sich unterhalten konnten.
Beunruhigte es mich, dass ich durch meine Arbeit im Prinzip die Apps intelligent genug machte, damit sie mich irgendwann nicht mehr brauchten? Ja. Aber in Wirklichkeit dachte ich nicht allzu viel darüber nach. Außerdem war es nicht die Technologie an sich, die mich in den Arsch getreten hatte, sondern International Transport.
Aber ich greife vor. An diesem Dienstagabend im Juni rannte ich die zwei Blocks von meiner Wohnung bis zum Washington Square Teleportation Center, kurz TC, in Rekordzeit. Mein Kom zeigte 21:29 Uhr an, als ich eintraf.
Überraschenderweise regnete es nicht. New York City erlebte eine der seltenen klaren Sommernächte, was bedeutete, dass nicht genug Kohlenwasserstoffe in der Luft waren, die von den Moskitos metabolisiert werden konnten. Normalerweise wurde die Skyline von Manhattan durch den Dunst der Schwärme aus Zillionen Moskitos verfinstert, die die Luftverschmutzung und schlechtes Wasser fraßen. Ein weiterer Teil des magischen Tanzes aus Chemie und Gentechnik, der uns Menschen am Leben erhielt, obwohl wir uns alle Mühe gaben, uns selbst zu vernichten.
Ich hoffe, wenn Sie dies lesen, haben wir eine elegantere Lösung für die Luftsynthese gefunden als lärmende, widerliche Insekten, die genetisch zu fliegenden Dampfreformern modifiziert wurden. Ich finde es in Ordnung, dass sie sich von Methan statt von Blut ernähren und Wasser ausscheiden, statt Krankheiten zu verbreiten, aber trotzdem sind sie verdammt nervig.
Ich überquerte die Straße zum Washington Square TC an der West Fourth Street. Im Gegensatz zu mehreren anderen Orten rund um die Welt, wo die TCs immer noch von einzelnen Demonstranten belagert wurden, die gegen die Umwälzungen in der Transportindustrie durch die Teleportation protestierten, oder von religiösen Verrückten, die die Menschen überzeugen wollten, dass diese Technologie Mord war, hatten die New Yorker sie wegen ihrer offensichtlichen Vorteile sofort akzeptiert. Davor waren die meisten religiösen Typen der Teleportation gegenüber zwiespältig eingestellt gewesen. Es war eine Art von »Verfrachtung« und kein Transport. Die bloße Vorstellung einer organischen Teleportation wurde bis 2109 als unrealisierbar betrachtet, als unmöglich wegen des Zappelproblems, weil Lebewesen ständig zappelig sind. Damals war ein gutes atomares Echtzeitmodell, das tatsächlich akkurat voraussagen und übermitteln konnte, was ein Lebewesen als Nächstes tun würde, noch ferne Zukunftsmusik.
Aber in meiner Zeit war dieses Problem vor zwanzig Jahren gelöst worden. Seit Kurzem war das Porten für manche viel zu beliebt geworden. Wer durch die Stadt teleportieren wollte, war wegen der Schlange vor dem nächsten TC häufig länger unterwegs als bei einem Drohnenflug oder einer Busfahrt. IT versprach immer wieder, dass die folgende Generation der TCs in der Lage sein würde, mehr als nur eine Person gleichzeitig zu befördern, aber man machte keine Angaben, wann dieses Versprechen Wirklichkeit werden sollte.
Die TC-Stationen, deren Eingangs- und Ausgangstüren mit dem markanten Schriftzug von International Transport verziert waren, konnte man kaum übersehen. Es waren kleine, rote, rechteckige Betongebäude, die wie eine Pockeninfektion auf dem Gesicht ihrer unmittelbaren Nachbarschaft aus dem Boden schossen – direkt neben öffentlichen Toiletten. Warum befanden sich alle TCs in der Nähe von öffentlichen Toiletten? Es gab keine plausible physiologische Erklärung dafür, aber die Teleportation neigte dazu, seltsame Dinge mit der menschlichen Blase zu machen.
Als Wissenschaftler erstmals Lebewesen porteten, stellten sie fest, dass komplexe Organismen, angefangen mit Tieren in der Größe von Katzen oder Hunden, bei jedem Transportvorgang anscheinend ein paar Gramm Gewicht verloren. Interessanterweise war das nicht der Fall, wenn dieselben Tiere eingeschläfert und dann teleportiert wurden. Manche religiösen Typen sahen im Gewichtsverlust den Beweis für eine Trennung von der Seele, aber da die geporteten Lebewesen ansonsten nicht durch die Änderung beeinträchtigt schienen, gab es nur zwei mögliche Schlussfolgerungen.
Entweder konnte sich die Seele regenerieren, was bedeutete, dass allen Geschöpfen, die größer waren als Katzen, einfach eine neue wuchs. Oder – was wesentlich plausibler war – der Gewichtsverlust hatte gar nichts mit der Seele zu tun und ließ sich auf einen ganz gewöhnlichen Paketverlust zurückführen. Fast alle unterschrieben die Paketverlusttheorie.
Ich begab mich auf das Förderband, das mich in den Bauch der Station brachte und an grauen Betonvorsprüngen und gebürsteten goldenen Säulen vorbei bis zu den Kronjuwelen gleiten ließ. Während ich die graue Nebelbank passierte, spürte ich das vertraute Kitzeln schwebender Nanos auf meiner Haut. Ich war schon viele Male geportet, aber etwas an diesem Gefühl einer metallischen Meeresgischt aus winzigsten Robotern, die meinen Körper scannten, verursachte mir immer wieder eine Gänsehaut. Der Nanitennebel katalogisierte nicht nur jede Zelle, Kleidungsfaser und Molekülanordnung innerhalb einer Person, sondern sie suchte auch nach eventueller Schmuggelware. Die telemetrischen Berechnungen und biologischen Prüfsummen wurden dann in einer Datenbank zusammengeführt, um ein Back-up meines letzten bekannten vollständigen Meta-Images zu erstellen. Der gesamte Prozess beanspruchte etwa fünf Sekunden. Am Ende des Förderbandes wies mir ein kleiner Pfeil den Weg zur kürzesten Schlange. Da es ein Dutzend Teleportationskammern gab und die Rushhour vorbei war, warteten nur zwei Personen vor mir.
Keine drei Minuten später betrat ich die Kammer. Der TC-Konduktor hatte meine Reisedaten bereits eingegeben, synchronisiert und mit meinem Kom abgeglichen. Eine niedrige schwarze Barriere mit gelben Streifen senkte sich vor der kleinen Punch-Puffer-Kammer – das Zeichen für mich, dass ich eintreten konnte. Hinter der Barriere stand ein einzelner, magnetisch aufgehängter Stuhl, ähnlich dem Sitz in einer Passagierdrohne, aber von glänzendem metallischem Gold umrahmt. Ich vermute, der Überfluss an Gold überall in den TCs sollte einen Eindruck von Opulenz vermitteln.
Sobald ich mich gesetzt hatte, schob eine automatische Fördervorrichtung den schwebenden Stuhl in die benachbarte Punch-Puffer-Kammer. An der Wand prangte das universelle Symbol fürs Stillhalten: Das Piktogramm einer Person, die auf einem Stuhl saß, und daneben eine Uhr.
Die Punch-Puffer-Kammer selbst war komplett in einem hellen Beige gehalten, abgesehen von einer schwarzen Chalzedon- Wand, zu der sich mein Stuhl um neunzig Grad herumdrehte. Das Wort FOYER erschien auf der Wand. Der Startraum einer Teleportation ist als FOYER markiert und der Zielraum als VESTIBÜL.
Unter dem FOYER-Schriftzug erschien eine Bildübertragung des Konduktors, der erneut meine Identität und mein Reiseziel verifizierte. Er war ein kahlköpfiger Asiate, der den Eindruck erweckte, dass er die meiste Zeit seines Lebens auf einem Stuhl verbracht hatte und darüber nicht allzu glücklich war. Mit monotoner Stimme erinnerte er mich daran, das juristische Kleingedruckte zu lesen, das holografisch vor meinem Gesicht erschien, und dann auf das nickende Emoji darunter zu tippen.
Eine Teleportation war ein ziemlich abgefahrenes Erlebnis. Eben noch war man ganz allein in einem kleinen Raum an einem Ort, und dann war man plötzlich ganz allein in einem identischen Raum an einem anderen Ort. Von außen betrachtet sah es ungefähr so aus, wie die Leute es sich vorgestellt hatten, bevor es Wirklichkeit wurde, nur dass es in umgekehrter Reihenfolge passierte. Die zu teleportierendePerson erreichte ihr Ziel etwa vier Sekunden, bevor sie verschwand. Das war schon recht hirnrissig.
Noch verrückter war, dass niemand wusste, wie es sich anfühlte, wenn man teleportiert wurde. Ich meine, klar, wir wussten, wie es sich anfühlte, irgendwo anzukommen, aber der eigentliche Reisevorgang lief so schnell ab, dass man überhaupt nichts davon spürte. Wir wussten nur, wenn das Licht wieder anging, waren wir bereits auf der anderen Seite.
Als die Personenteleportation eingeführt wurde, gab es viele Videos, die den Punch-Puffer-Prozess demonstrierten. In einem Moment saß jemand auf dem Stuhl, im nächsten war er nur noch Staub und Dampf. Es sah schockierend aus, aber es war völlig harmlos. IT zufolge war der kurze, geisterhafte Umriss des Teleportierten einfach nur die Staubschicht, die zurückblieb, wenn er weggebeamt wurde. Der Prozess ging so schnell vonstatten, dass die Wassermoleküle, die abgestorbenen Hautzellen und andere Partikel am Körper und an der Kleidung, die nicht zum Ziel gesendet wurden, noch einen Herzschlag lang in der Luft hingen, ungefähr wie die vogelförmige Staubwolke, die der Road Runner hinterließ, wenn er vor Wile E. Coyote in den alten Zeichentrickkurzfilmen von Warner Bros. aus den 1950ern die Flucht ergriff. Ich weiß, Sie halten mich wahrscheinlich für langweilig, weil ich mir zweihundert Jahre alte Zeichentrickfilme ansehe, aber was soll ich dazu sagen? Ich mag nun mal gute Sachen.
Ich war schon ziemlich oft geportet, also war ich mir nicht sicher, warum ich in diesem Moment an all diese Dinge dachte. Es ist, als würde man sich kurz vor dem Schlafengehen erinnern, dass es den plötzlichen nächtlichen Herztod tatsächlich gibt.
Manchmal ist mein Gehirn einfach nur ein Arschloch.
Schnell überflog ich das kleingedruckte juristische Geschwafel, das vor mir schwebte. Dann tippte ich auf das nickende Emoji – Ich bin einverstanden.
Der Raum wurde für etwa drei oder vier Sekunden völlig finster, dann gab es einen hellen weißen Blitz, und als das Licht anging, fand ich mich in einem identischen Raum wieder, jedoch mit einem Unterschied: An der Wand vor mir stand VESTIBÜL.
»Willkommen im Times Square TC«, sagte die neue Konduktorin in der Bildübertragung an der Wand. Vielleicht war sie erst vor Kurzem eingestellt worden, weil ihr apfelwangiges Gesicht mit dem aufrichtigen Lächeln wesentlich freundlicher war als der leblose Blick und die monotone Begrüßung des vorigen Konduktors. Oder vielleicht machte es einfach nur mehr Spaß, wenn man sah, wie Leute ankamen.
Der schwebende Stuhl zog sich in den Vorraum zurück. Die Barriere senkte sich, und ich trat in ein TC, das etwa zwei Kilometer von dem entfernt war, aus dem ich soeben verschwunden war. Diese Reise hatte mich fast ein ganzes Tagesgehalt gekostet, aber ich war dort, wo ich sein musste, und statt über dreißig kam ich nur sieben Minuten zu spät zu meiner Verabredung mit Sylvia.
Ich rannte aus dem TC auf den Times Square, wand mich durch die Horden der Selfies schießenden Touristen und die riesigen flirrenden Hologramme, dann bog ich in eine kleine Seitenstraße ab und fand mich vor unserem alten Collegetreff wieder, dem Mandolin.
Der Türsteher überprüfte mein Kom und winkte mich durch den Vordereingang. Der Laden hatte seinen Namen vom lackierten antiken Bartresen. Er bestand aus ausrangierten, kaputten Saiteninstrumenten, die im Lack eingefroren waren. Hauptsächlich Mandolinen und ein gelegentlicher Überrest einer Ukulele oder Gitarre dazwischengeworfen, um der künstlerischen Ausgewogenheit willen. Ansonsten hatte das Ganze das Flair einer Kleinbrauerei-Gaststätte aus dem frühen einundzwanzigsten Jahrhundert mit stilechten Bierzapfhähnen, handgemixten Cocktails und kuriosen handgeschriebenen Speisekarten auf echten Kreidetafeln.
Ich scannte den größtenteils leeren Innenraum. An einem Dienstagabend waren nur die ernsthaften Trinker anwesend. Als ich mir noch einmal die etwa zehn Gesichter ansah undmich darauf verließ, dass mein Kom Sylvia erkennen würde, selbst wenn sie gerade in eine andere Richtung blickte, arbeitete ich an einer geistreichen, aber plausiblen Erklärung für meine Verspätung.
Bedauerlicherweise brachte mein Gehirn keine zustande, bevor ich von hinten angegriffen wurde.
Tal M. Klein: „Der Zwillingseffekt“ ∙ Roman ∙ Aus dem Amerikanischen von Bernhard Kempen ∙ Wilhelm Heyne Verlag, München 2018 ∙ 416 Seiten ∙ Preis des E-Books € 11,99 (im Shop)



Kommentare