SenSpace
Chris Becketts „Messias-Maschine“
Kürzlich erzählte mir ein Freund, in Deutschland gäbe es an Autobahnraststätten Münzautomaten mit »Traveller Pussies«: künstlichen Vaginas, offenbar für den dringenden »Bedarf« der Fernfahrer erschaffen und um wohlfeile zwei Euro erhältlich. Jämmerlich, gewiss, doch es führt uns geradewegs in die zukünftige Welt dieses erstaunlich guten Buches … In Illyria – einem fiktiven adriatischen Gebiet, in das sich im 21. Jahrhundert Wissenschaftler vor der zunehmenden Fortschrittsfeindlichkeit zurückgezogen haben – lebt George Simling als Übersetzer in einer vielsprachigen Welt: 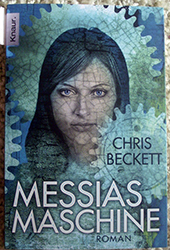 aufgeteilt in letzte Inseln von Rationalität und Wirtschaft auf der einen und große, vorindustriell anmutende Gebiete auf der anderen Seite, in denen die Religion den Ton angibt. George wächst privilegiert auf und scheint nur zwei Prioritäten im Leben zu haben: seinen Job gut zu machen, und seine Mutter alle paar Stunden umzudrehen, damit sie nicht wundliegt. Sie verbringt die meiste Zeit ihres Lebens nämlich, wie so viele andere, freiwillig im SenSpace – einer über Datenanzüge erfahrbaren virtuellen Welt, in der die vom realen Leben Enttäuschten ein zeitweiliges Refugium finden; Realitätsflucht par excellence.
aufgeteilt in letzte Inseln von Rationalität und Wirtschaft auf der einen und große, vorindustriell anmutende Gebiete auf der anderen Seite, in denen die Religion den Ton angibt. George wächst privilegiert auf und scheint nur zwei Prioritäten im Leben zu haben: seinen Job gut zu machen, und seine Mutter alle paar Stunden umzudrehen, damit sie nicht wundliegt. Sie verbringt die meiste Zeit ihres Lebens nämlich, wie so viele andere, freiwillig im SenSpace – einer über Datenanzüge erfahrbaren virtuellen Welt, in der die vom realen Leben Enttäuschten ein zeitweiliges Refugium finden; Realitätsflucht par excellence.
George ist das, was man in der Literatur gemeinhin einen »Antihelden« nennt: niemand, von dem man das aktive Ankämpfen gegen Probleme erwartet, sondern eine fast schon kafkaeske Gestalt – stumm verstrickt in ein technokratisches »System«, welches Individuen keinen Wert zuerkennt. Gerade seine Arbeit als Dolmetscher – dem Nachsprechen von Worten, die andere sagen – illustriert und vergrößert seine eigene Stummheit und Passivität. Wir haben hier also ein wunderbares Beispiel dafür, wie wichtig – weil symbolhaft – die vom Autor getroffene Berufswahl eines Protagonisten ist (stellen Sie sich vor, Kafkas Josef K. wäre Musiker oder Pferdejockey gewesen, nicht auszudenken).
Obwohl es sich um den Erstlingsroman von Chris Beckett handelt (er trat bisher als – auch preisgekrönter – Kurzgeschichtenschreiber auf), hat er genau das richtige Gespür dafür, wann es an der Zeit ist, die lähmende Passivität aufzubrechen und seinen Antihelden George vor zwei Probleme gleichzeitig zu stellen: Zuerst entgeht er bei einer Dienstreise knapp einem Anschlag (und lernt dabei die reale Welt außerhalb der sicheren Mauern Illyrias kennen), und anschließend vertieft sich seine jungenhaft-vorsichtige Zuneigung in eine Syntec-Frau auf verhängnisvolle Weise. Hiermit wären wir beim eingangs angesprochene Thema, denn denken wir Phänomene wie »Traveller Pussies« weiter, wird unsere Gesellschaft in ein oder zwei Jahrzehnten künstliche Ganzkörpersklavinnen erschaffen – Syntecs eben, die jeden noch so perversen Wunsch ihrer Freier stumm und dankbar erfüllen.
Lucy – jene Syntec, in die George sich trotz aller Rationalität verliebt – geschieht nun das, was in Science-Fiction-Romanen über künstliche Wesen leider allzu oft passiert: Sie entwickelt ein Bewusstsein. Schlauerweise nicht durch einen Blitzschlag oder einen Computervirus, sondern durch das regelmäßige Lesen der Bibel. Was man dem Autor als Konservativität auslegen könnte, greift jedoch tiefer und ist weitaus vielschichtiger: Nichts weniger unternimmt er auf den nun folgenden – durchaus actiongeladenen – Seiten als einen philosophischen Abgleich der verschiedenen Glaubenspotenziale von »Religion« und »Wissenschaft«. Wer wäre dazu besser geeignet als ein kindlich erwachender Geist, der naiv und unvoreingenommen die Welt zu verstehen beginnt?
Freilich scheint Beckett zu wissen, dass er sich bei diesem Thema mit den ganz Großen misst – allen voran Isaac Asimov und seinen Robotergeschichten. Vielleicht vermeidet er es darum, jene Fragen in letzter Konsequenz zu durchdenken – denn bevor es zu philosophisch wird, verlangt die Handlung nach spannungsgeladenen Ortswechseln (George und Lucy flüchten aus Illyria) und gefährlichen Situationen: Eine Sexsklavin ist, auch wenn sie sich als Mensch verkleidet, im öffentlichen Raum sofort das Objekt der Begierde aller Männer – zumal wenn diese in einer scheinbar tief religiösen, aber heuchlerischen Gesellschaft leben, die in Wahrheit nur zurück zu ihren patriarchalischen Wurzeln strebt. Sehr dicht und gekonnt entwickelt Beckett hier mehrschichtige Bedrohungsszenarien, wenn sich etwa in einer Kneipe aus einem unverfänglichen Gespräch mit anderen Männern Wort um Wort ein verbales Umkreisen der Beute (nämlich Lucy) entwickelt und George in seiner Ängstlichkeit genau jene passive Unfähigkeit demonstriert, mit der »feminisierte« westliche Kulturen dem Machismo-Verhalten osteuropäischer oder arabischer Gesellschaften gegenübertreten. Sehr gewagt, aber köstlich ist es, wenn der Autor diese ständige, schwebende Unsicherheit noch übersteigert und plötzlich humoristische Registerbrüche zieht, indem Lucy (innerlich immer noch halb Sexmaschine) »unerwartete« Kommentare in herkömmliche Dialoge einflicht, indem sie ihrem Gegenüber etwa einen »Blow Job« in Aussicht stellt oder naiv-programmiert fragt, ob sie ihm ihren Körper anbieten könne. Das Timing dieser »Oneliner« ist dabei so perfekt, dass die Szenen wie gehobener Slapstick statt wie geschmacklose Herrenwitze wirken. Gerade in diesem Nebeneinander von Tragödie und Komödie offenbart sich das große Talent dieses Autors.
Würde er jedoch auf dieser Ebene verharren, wäre »Messias-Maschine« nicht viel mehr als eine weitere, an A.I. – Artificial Intelligence oder Matrix gemahnende Robotergeschichte. Dann jedoch setzt Beckett literarisch noch eins drauf, schmeißt jeglichen Witz über Bord und dekliniert auf grausamste Weise durch, wohin die zunehmende Verrohung einer Gemeinschaft führt, die zwischen drei Extremen schwankt: gefühlloser Technologie, mittelalterlicher Religionsherrschaft und zügelloser Sexualität. Wenn diese Faktoren zusammenkommen, zeigt Beckett auf, bringen sie das Schlimmste im Menschen zum Vorschein. Und so erspart er uns weder die Szene, in welcher Lucy von einem Mob in religiösem Eifer quasi auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird, noch jene, in welcher der durchs Gebirge flüchtende George selbst von drei Jägern vergewaltigt wird. Es ist gerade die letztere Schilderung, welche mir auch nach mehreren Monaten noch im Gedächtnis haften bleibt: wie George als Ich-Erzähler das demütigende, schmerzhafte Erlebnis so schildert, als geschähe es einem anderen, den er distanziert betrachtet, um nicht dem Wahnsinn zu verfallen:
»Aus großer Höhe sah ich zu, wie sie mich einer nach dem anderen misshandelten. Mir fiel auf, dass es schrecklich weh tat. Es fühlte sich an, als würden meine Eingeweide der Länge nach aufgerissen.«
In diesem Hin und Her aus externer, rationaler Interpretation (»Mir fiel auf …«) und dann wieder persönlichem Erleben (»Es fühlte sich an …«) wird das Geschehen auf mitreißende Weise subjektiv nachvollziehbar und gibt der Person eine lebendige Tiefe, die über konventionelle Beschreibungen weit hinausgeht.
Wir wollen nicht verschweigen, dass selbst der Schluss des Romans noch die eine oder andere Überraschung bereithält, ja sogar die Identität eines geheimnisvollen »Messias« aufgedeckt wird, welcher in jenen verzweifelten Landen eine zunehmend große Anhängerschar begeistert. Ein Messias, der ganz am Ende, als George ihn erstmals trifft, zum Glück wieder jenen überraschenden, wie ein Schlag treffenden Humor auferstehen lässt, welcher einer dramatischen Geschichte letztlich den doch noch versöhnlichen Hauch einer Komödie verleiht. Ein absolut empfehlenswertes Buch.
Chris Beckett: Messias-Maschine • Roman · Aus dem Englischen von Jakob Schmidt · Knaur Verlag, München 2012 · 332 Seiten · € 9,99

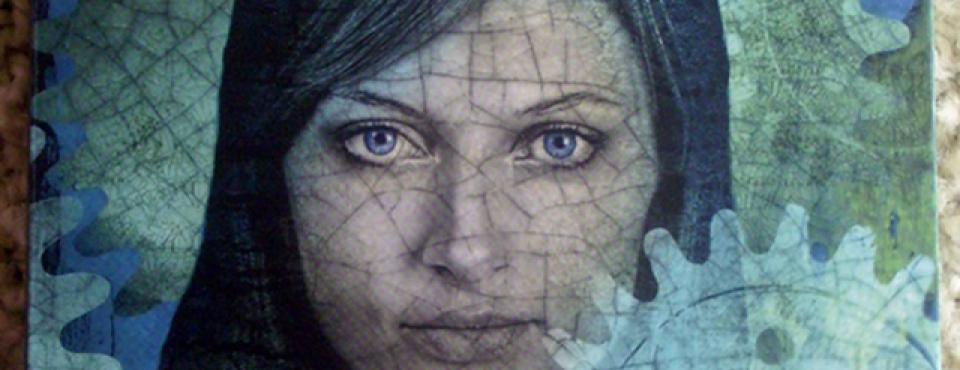

Kommentare