„Was passiert, wenn aus den Piraten Admiräle werden?“
Ein Gespräch mit Cory Doctorow über „Walkaway“, Bohrmaschinen und wahren Wohlstand – Teil 1
Anfang November war Cory Doctorow für einige Tage in Deutschland, unter anderem, um in Berlin aus seinem neuesten Roman „Walkaway“ zu lesen und auf dem Audi MQ! Innovation Summit zu sprechen. Dazwischen hat sich der kanadischstämmige Autor, der seit einigen Jahren mit seiner Familie in den USA lebt, Zeit für einen kurzen Besuch bei seinem Verlag in München genommen – und für ein Gespräch mit diezukunft.de.
Lassen Sie uns zu Beginn ein wenig über Ihren letzten Roman, „Walkaway“ (im Shop), sprechen. Was hat Sie dazu inspiriert, diesen Roman zu schreiben?
Natürlich haben Bücher immer eine komplexe Vorgeschichte, und viele verschiedene Dinge tragen zu ihrer Entstehung bei. Bei „Walkaway“ waren es vor allem drei Bücher, die mich dazu angeregt haben, diesen Roman zu schreiben. Das erste ist Rebecca Solnits „A Paradise built in Hell“. Sie ist Historikerin und vor allem dafür bekannt, den Begriff „Mansplaining“ geprägt zu haben. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber Mansplaining ist, wenn ein Mann einer Frau etwas erklärt, das sie bereits weiß. [Lacht.]
Oh, vielen Dank. Das war mir gänzlich neu.
[Lacht.] Im Ernst, sie ist brillant, und alles, was sie tut, ist exzellent. In „A Paradise built in Hell“ untersucht sie, wie Betroffene sich an Katastrophen erinnern. Bei solchen Ereignissen drehen viele Menschen durch, aber es sind auch Zeiten, in denen sich Menschen gegenseitig helfen. Die Betroffenen erlebten die Katastrophe tatsächlich als eine Zeit der Kooperation und des guten Willens. Kleine persönliche Streitereien wurden beiseitegelegt, und jeder erfuhr Solidarität. Aber die reichen Leute sind davon überzeugt, dass die Armen ihnen an den Kragen wollen, und das wollen sie verhindern. Sie können nicht glauben, dass das nicht passieren wird. Mir ist aufgefallen, dass eine Katastrophe oft der Ausgangspunkt der Handlung vieler Romane ist: etwas Schreckliches passiert, und schon werden alle Menschen zu den Barbaren, die sie insgeheim schon immer waren, es aber nie zeigen konnten, weil die gesellschaftlichen Normen das unterdrückt haben. Aber jetzt heißt es „jeder gegen jeden“, und du und die anderen drei Leute, die sich als gute Menschen herausgestellt haben, müssen gegen all diese schlechten Menschen kämpfen. Das ergibt schon statistisch gesehen keinen Sinn. Ich meine, was ist wahrscheinlicher: dass 99,99 Prozent aller Menschen total schlecht sind, aber jeder, den Sie persönlich kennen, okay ist, oder dass jeder, den Sie kennen, im Grunde den Durchschnitt repräsentiert und zu seinen besten Zeiten wunderbar und zu seinen schlechtesten Zeiten schrecklich ist?
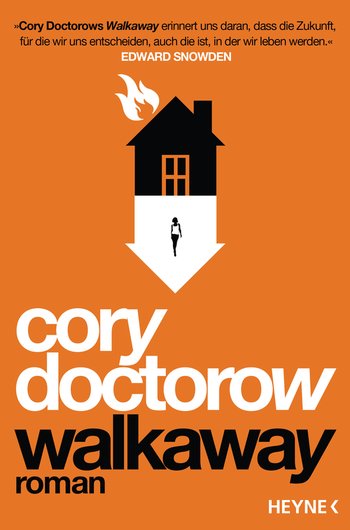 Das zweite Buch, das „Walkaway“ beeinflusst hat, war David Graebers „Schulden. Die ersten 5.000 Jahre“. Darin zeigt er, wie Geld, Wohlstand und Schulden miteinander zusammenhängen, und dass viele der Geschichten über Geld, nicht wahr sind. Der Autor -ein Anthropologe und Anarchist, der in der Occupy-Bewegung involviert ist - hat eine Reihe interessanter Bücher und Essays geschrieben. Eines, das für meine deutschen Leser interessant sein könnte, ist „Bürokratie: Die Utopie der Regeln”. Darin legt er dar, dass die Dinge, von denen der Kapitalismus behauptet, sie seien schlecht am Sozialismus, inzwischen zu einem Teil des Kapitalismus geworden sind. Etwa, dass man sich am Flughafen lange anstellen muss, oder dass man hohe bürokratische Hürden überwinden muss, um etwas vom Staat zu bekommen, oder dass alle Geschäfte dieseleben Dinge verkaufen, weil wir in einer „The winner takes it all“-Ökonomie leben, und so weiter. Und es gibt eine ganze Reihe von „Bullshit Jobs“ – das ist ein anderes Buch, das er geschrieben hat -, die eigentlich niemandem etwas nützen.
Das zweite Buch, das „Walkaway“ beeinflusst hat, war David Graebers „Schulden. Die ersten 5.000 Jahre“. Darin zeigt er, wie Geld, Wohlstand und Schulden miteinander zusammenhängen, und dass viele der Geschichten über Geld, nicht wahr sind. Der Autor -ein Anthropologe und Anarchist, der in der Occupy-Bewegung involviert ist - hat eine Reihe interessanter Bücher und Essays geschrieben. Eines, das für meine deutschen Leser interessant sein könnte, ist „Bürokratie: Die Utopie der Regeln”. Darin legt er dar, dass die Dinge, von denen der Kapitalismus behauptet, sie seien schlecht am Sozialismus, inzwischen zu einem Teil des Kapitalismus geworden sind. Etwa, dass man sich am Flughafen lange anstellen muss, oder dass man hohe bürokratische Hürden überwinden muss, um etwas vom Staat zu bekommen, oder dass alle Geschäfte dieseleben Dinge verkaufen, weil wir in einer „The winner takes it all“-Ökonomie leben, und so weiter. Und es gibt eine ganze Reihe von „Bullshit Jobs“ – das ist ein anderes Buch, das er geschrieben hat -, die eigentlich niemandem etwas nützen.
Das dritte Buch, das mich zu „Walkaway“ inspiriert hat, war Thomas Pikettys „Das Kapital im 21. Jahrhundert“. Piketty ist ein französischer Wirtschaftswissenschaftler, und er und seine Doktoranden haben ein Jahrzehnt damit zugebracht, die Veränderungen bei der Verteilung von Vermögen der letzten 300 Jahre zu untersuchen. Er kam zu dem Schluss, dass das Wirtschaftswachstum geringer ist, als das Wachstum des Einkommens aus Kapital.
Einer der Mythen des Kapitalismus ist, dass die Reichen deshalb reich sind, weil sie etwas Außergewöhnliches geleistet haben. Aber in Wirklichkeit sind die Leute reich, weil sie reich geboren wurden. Piketty führt als Beispiel Liliane Bettencourt an, die L’Oréal-Erbin und ehemals reichste Frau der Welt, die in ihrem ganzen Leben keinen einzigen Tag gearbeitet hat. Er vergleicht ihr Vermögen über einen längeren Zeitraum hinweg mit dem von Bill Gates, der bekanntlich die erfolgreichste Firma der Welt gegründet hat, dann in Rente ging und Investor wurde. Bettencourt hat in der Zeit, die Microsoft gebraucht hat, um zum erfolgreichsten Unternehmen der Welt zu werden, mehr Geld verdient als Bill Gates. Und Bill Gates der Investor hat mehr Geld verdient als Bill Gates der Firmengründer, indem er nichts anderes gemacht hat als Geld zu bewegen. Er wurde dafür belohnt, dass er in Rente ging. Das wird dem Mythos von den herausragenden Leistungen der Reichen alles andere als gerecht!
Piketty führt aus, dass das, was wir im Rahmen der sozialen Mobilität für den normalen Lauf der Dinge halten, in Wirklichkeit ein Ergebnis der beiden Weltkriege ist, die so viel Kapital zerstört haben, dass der Griff des obersten Zehntels geschwächt wurde. Danach gab es eine Politik, die die soziale Mobilität gefördert hat. Aber weil das Einkommen aus Kapital inzwischen schneller wächst als die Wirtschaft in diesen dreißig glorreichen Jahren zwischen den Vierzigern und den Siebzigern, kommen ab Mitte der Siebziger Politiker wie Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Helmut Kohl und Augusto Pinochet, die den Reichen das Wasser tragen und dadurch den Prozess, der die Reichen noch reicher macht, noch weiter beschleunigen. Deswegen haben wir jetzt diese „Winner takes it all“-Welt, in der Bertelsmann Penguin und Disney Fox kauft, in der alles entweder gigantisch groß ist oder quasi nicht existiert, in der die Reichen mehr Kapital anhäufen als je zuvor.
Wenn man alle diese drei Aspekte aus diesen drei Büchern weiterdenkt, kommt man zur Ausgangslage von „Walkaway“.
Was mich daran immer so fasziniert, ist, dass es so klingt, als wäre es gar nicht real. Sie sagen, Bill Gates der Investor verdient jetzt mehr als Bill Gates der Firmengründer – aber dieses Geld ist nicht real. Er hat diese Milliarden ja nicht, nur auf dem Papier. Verstehen Sie, was ich meine?
Ja, absolut.
Das ist ein imaginäres Konstrukt, das eines Tages zusammenbrechen wird.
Genau. Deswegen wird inzwischen ja auch eine Umverteilung des Kapitals als ökonomisch effizient angesehen. Ab einem gewissen Reichtum kauft man sich keine Sachen mehr. Und die Dinge, die man sich kauft, erzeugen keine oder nur sehr wenige Jobs. Nehmen Sie Superluxusjachten: So eine Jacht entspricht im Wert zehn Millionen Tiefkühlhähnchengerichten. Aber sie schafft bei Weitem nicht so viele Jobs wie Tiefkühlhähnchen. Was Sie sagen, ist richtig, und das spiegelt sich auch in der Modern-Monetary-Theory wieder, die eine Neuauflage einer alten Idee, des Chartalismus, ist und im Zusammenhang mit der Schuldenkrise in Griechenland und Deutschlands Weigerung, einen Schuldenerlass zu gewähren, wiederbelebt wurde. Der Grundgedanke ist, dass sich Staaten, die ihre Währung selbst kontrollieren, nicht durch Steuern finanzieren müssen. Die Währung entsteht, wenn die Regierung beschließt, etwas zu kaufen. Das ist der einzige Weg, auf dem Geld in die Wirtschaft gelangen kann: der Staat druckt Geld und muss es dann ausgeben, damit es in Umlauf kommt. Wenn zu viel Geld in Umlauf ist, erhebt die Regierung Steuern, sodass es wieder in die Staatskasse zurückkommt, wo es dann verschwindet, bis die Regierung es wieder erzeugt, weil sie es braucht. Nach dieser Theorie entsteht eine Inflation dann, wenn die Regierung mehr Waren kauft, als das Land erzeugen kann, wodurch ein Preiskampf entsteht, bei dem jeder seine Konkurrenz unterbieten muss.
Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Fabrik, die pro Tag 500 Kleiderbügel produzieren kann. Der Markt braucht aber nicht mehr als 250 Kleiderbügel pro Tag. Wenn die Regierung die anderen 250 Kleiderbügel kauft, erzeugt das Jobs – mehr nicht. Es ändert nichts an der Nachfrage nach Kleiderbügeln. Das ist eine sehr spannende Idee, die diese ganzen Inflationsfalken, also die Leute, die uns die Sparpolitik eingebrockt haben, mit der wir die letzten zwanzig Jahre gelebt und die uns letztendlich in die Finanzkrise von 2008 geführt haben, ziemlich unter Druck setzt.
Die Sparprogramme haben auch zu mindestens zwei sehr interessanten Science-Fiction-Romanen geführt: „Walkaway“ und Kim Stanley Robinsons „New York 2140“ (im Shop). Haben Sie Robinsons Roman gelesen?
Oh ja, „New York 2140“ ist wundervoll! Und Stan ist ein Freund von mir, der mir auch ein Zitat für „Walkaway“ gegeben hat.
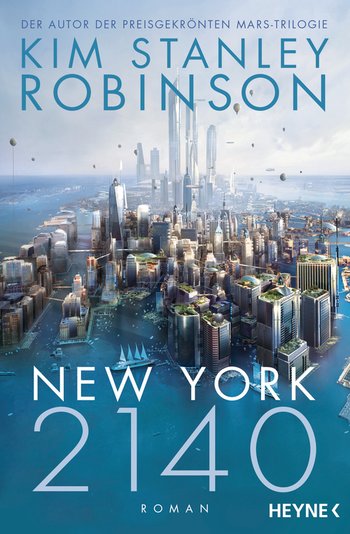 Er hat eine etwas andere Lösung für eine durchaus ähnliche Ausgangssituation, in der sich die Figuren beider Romane befinden.
Er hat eine etwas andere Lösung für eine durchaus ähnliche Ausgangssituation, in der sich die Figuren beider Romane befinden.
Stimmt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Stan auch ein Modern-Monetary-Theorie-Anhänger ist. Und er bezeichnet sich selbst als Sozialist. Wir sehen das Thema also sehr ähnlich.
Was ich bei Stans letzten Romanen so aufregend finde, ist, dass er zuerst einen Roman geschrieben hat, der 300 Jahre in der Zukunft spielt und in dem all diese Krisen gekommen sind und überwunden wurden. Sie waren schrecklich, aber die Menschheit hat sie hinter sich gebracht und lebt jetzt in einer neuen Welt mit neuen Krisen. Krisen, wie sie nur entstehen können, wenn man alle anderen Krisen vorher überlebt hat. Ich rede natürlich von „2312“ (im Shop). Dann hat er „Aurora“ (im Shop) geschrieben, der zeitlich auf halbem Wege zu „2312“ angesiedelt ist und in dem er die Ereignisse schildert, die uns fast ans Ziel gebracht hätten. Und dann kam „New York 2140“, das wiederum auf halber Strecke der halben Strecke zu „2312“ liegt. Sein nächster Roman, der bald in den USA erscheint, heißt „Roter Mond“ und liegt wiederum auf halbem Wege zu „New York 2140“. Es scheint, als würde Stan von „2312“ rückwärts gehen, bis er wieder in der Gegenwart angekommen ist. Wenn Kinder ein Labyrinth auf einem Blatt Papier lösen müssen, machen sie das manchmal genauso: Wenn sie den Ausgang nicht finden können, fangen sie manchmal am Ausgang an und arbeiten sich zum Start vor. Ich finde es großartig, was Stan da macht!
Im Gegensatz dazu steht „Walkaway“ alleine da, und der Roman verschweigt obendrein eine ganze Menge Details.
Nun, „Walkaway“ steht noch alleine da.
Ja, vielleicht mache ich das eines Tages auch. Ich glaube nicht, dass Stan das so geplant hat. Wahrscheinlich hat er sich beim Schreiben von „2312“ gefragt, wie unser Weg dorthin aussehen würde.
Ich habe „Walkaway“ direkt nach „New York 2140“ gelesen, und mich haben die Ideen zur Veränderung unserer Gesellschaft in beiden Romanen wirklich fasziniert. Ich würde sagen, dass Robinsons Protagonisten das System von Innen heraus verändern, indem sie die Stellschrauben neu justieren, wohingegen die Walkaways es von Außen versuchen, indem sie eine neue Art des Zusammenlebens vorleben.
„New York 2140“ zeigt auch eine Art Demimonde, die offiziell geworden ist. Ich würde sagen, es ist gewissermaßen „Walkaway 20 Jahre später“, wenn all den kleinen Walkaway-Enklaven offiziell gestattet worden ist, das Land, das sie zuvor okkupiert haben, zu benutzen. Das erzeugt einen neuen Konflikt zwischen den Leuten, die plötzlich einen formellen Anspruch auf etwas haben, das vorher semi-formell war, und den Menschen aus der Finanzwelt, die einen Anspruch auf etwas anmelden, weil es auf dem Papier ihnen gehört.
Also ist die Gesellschaft in „New York 2140“ das, was aus der Walkaway-Gesellschaft wird, wenn sie „Default“ wird?
Ja, vielleicht [lacht]. Ohne jetzt das Ende meines Romans verraten zu wollen, aber das könnte das sein, was im Epilog passiert. Wir sind alle zusammen auf dem Weg in diesen Epilog.
Das war eine der Fragen, die ich mir nach der Lektüre Ihres Romans gestellt habe. Was passiert eigentlich, wenn alle zu „Walkaways“ werden? Wenn diese Form der Gesellschaft zur neuen Normalität wird?
Was passiert, wenn aus den Piraten Admiräle werden? Das ist eine gute Frage. Wenn man zum Establishment wird, entstehen Institutionen und Praktiken, deren Rechtfertigung irgendwann nicht mehr klar ersichtlich ist, die aber dazu beitragen, dass wir uns sicher fühlen und obendrein unsere soziale Macht stärken. Ein Satz in „Walkaway“, der auch in vielen meiner anderen Romanen auftaucht, lautet: „Ganz egal, wie sehr du dich bemühst, die kleinen Ärsche zeigen dir immer, wo die Kluft zwischen den Generationen liegt.“ Den habe ich aus William Gibsons „Neuromancer“ (im Shop) geklaut, und es ist eines meiner Lieblingszitate. Die nachfolgende Generation hängt uns ab, indem sie behauptet, dass das, was wir wertschätzen, entweder nie wirklich wertvoll war, oder dass es etwas ist, dessen Zeit gekommen und wieder vergangen ist. Wie wir, als wir vor Beginn dieses Interviews über die neue Isaac-Asimov-Biografie gesprochen haben, in der sein schreckliches Verhalten gegenüber Frauen thematisiert wird. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem man seine Lieblinge ermorden muss. Es gibt Leute, die die letzten vierzig Jahre davon gelebt haben, dass sie mal mit Asimov befreundet waren, und die geraten jetzt, da er zu persona non grata geworden ist, ganz schön ins Trudeln. Mit der Me-too-Bewegung ist es dasselbe. „Harvey Weinstein liebt mich und hat mich zum Mittagessen eingeladen!“ ist nicht länger etwas, mit dem man angeben kann!
Ich habe dasselbe Problem mit Harlan Ellison (im Shop). Ich liebe seine Geschichten – aber sobald man anfängt, sich mit der Person dahinter zu befassen, denkt man nur: „Was? Oh, Mist!“
Mir geht es genauso. Harlan war mein Lehrer, und ich habe ihn verehrt. Man sagt, wenn man mit 17 kein Harlan-Ellison-Fan ist, hat man keine Seele. Wenn man mit 40 immer noch ein Harlan-Ellison-Fan ist, hat man kein Gehirn. [Lacht.]
Er war wirklich mein literarischer Held, und ich habe viel von dem Mythos geglaubt, den er um seine Person gewoben hat. Aber er war nicht nur ein schlechter Lehrer, sondern auch ein ziemlich grausamer. Er hat sich einen Sündenbock und einen Engel ausgesucht, und den Sündenbock hat er dann aufs Schrecklichste beschimpft und den Engel in den Himmel gelobt. In Wirklichkeit waren beide sehr nette Menschen und gute Schriftsteller, und keiner von ihnen war so furchtbar oder so grandios. Es war komplett willkürlich, und es war gemein. Ich glaube, er hat das gemacht, um sich selbst größer erscheinen zu lassen. Mit seinem Verhalten Frauen gegenüber ist es dasselbe: er hatte eine Empathie-Lücke. Wir alle haben blinde Flecken in unserer Empathie, aber die Marke Ellison war so sehr um die Empathie gestrickt … Er war ein komplizierter Typ. Eine Sache, die ich von ihm gelernt habe, ist, dass sich die guten und die bösen Taten eines Menschen nicht ausgleichen. Sie koexistieren einfach nur. Das Leben ist keine Waagschale, und die guten Taten einer Person löschen ihre Sünden nicht aus dem Register. Und umgekehrt löschen auch die schlechten Taten die guten nicht aus. Sie sind, was sie sind. Sie können nicht mehr rückgängig gemacht werden. Die Opfer von Beleidigungen und Missbrauch kommen entweder darüber hinweg oder nicht, ganz gleich, ob derjenige, der sie beleidigt hat, gewisse Tugenden mitbringt, die sie anerkennen können, oder nicht.
Ich finde es gut, dass ich mich nicht für oder gegen „Team Harlan“ entscheiden muss. Ich kann in Team „Harlans Stories sind gut“ sein und zugleich in Team „Harlans Verhalten war unentschuldbar“.
Wenn jemand etwas tut, das Sie emotional nicht so einfach überwinden können, funktioniert das nicht mehr. Wenn Sie oder jemand, der Ihnen nahesteht, verletzt werden. Das kann die Art, auf die wir das künstlerische Werk dieser Person wahrnehmen, zum Negativen beeinflussen. Es ist egal, wie gut der Punsch schmeckt, wenn ein Stück Scheiße darin schwimmt. Das ist ziemlich schwer zu ignorieren, selbst wenn jemand die Scheiße herausgefischt hat und versichert, dass keine Bakterien mehr im Punsch sind [lacht]. Das kann die ästhetische Dimension des Werks verändern. Aber ich glaube nicht, dass es das Werk komplett wertlos macht.

Kommen wir noch einmal auf die Kluft zwischen den Generationen zurück, über die wir gerade gesprochen haben. Ich finde die nämlich gar nicht so schlecht. Er erinnert mich ein bisschen an Trotzki und seine permanente Revolution, aber eben nicht auf einer politischen, sondern auf einer sozialen Ebene, wenn Sie verstehen, was ich meine.
Sie kennen doch sicherlich dieses Diagramm von der Evolution der Menschheit, das mit so kleinen Tierchen anfängt, und dann kommen verschiedene Affen, die immer größer werden, und am Ende dann der Mensch? Es suggeriert, dass wir das Endergebnis eines zielgerichteten Prozesses sind. Aber bei der Evolution dreht sich alles darum, sich an ganz spezifische Situationen anzupassen. Wir wissen noch nicht, ob wir Menschen tatsächlich der Gipfel der Evolution sind [lacht]. Aber diese Angepasstheit, die Tauglichkeit, ist kein empirisches Charakteristikum, weil sie sich immer auf einen bestimmten Moment und auf bestimmte Umstände bezieht. Und sobald dieser Moment vorbei ist und die Umstände sich ändern, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man danach immer noch am tauglichsten sein wird, eher gering.
Ich nahm kürzlich an einer Diskussionsrunde mit Stewart Brand teil, der in den Sechzigern den „Whole Earth Catalog“ gegründet hat, in den Achtzigern dann THE WELL, die erste Online-Community, und die Hacker’s Conference, und schließlich die Long Now Foundation. Dieser Typ hat schon viel gesehen, viel erlebt und viel getan, und das schlägt sich in jeder neuen Sache, die er angeht, nieder. Das bringt natürlich gewisse Vorteile mit sich, aber es hat auch einen Nachteil: Man ist zu starr auf die Dinge fixiert, die einem selbst wichtig erscheinen. Es ist wie mit Arthur C. Clarke (im Shop) und seinen Gesetzen. Sie besagen, dass immer, wenn ein älterer, verdienter Wissenschaftler behauptet, etwas sei möglich, es auch tatsächlich möglich ist. Aber immer, wenn er sagt, etwas sei unmöglich, stimmt das so wahrscheinlich nicht. Bestenfalls wissen wir irgendwann, was möglich ist und was nicht. Aber dadurch verlieren wie die Fähigkeit, das Unmögliche zu entdecken.
Wo wir gerade bei Dingen sind, die vielleicht unmöglich sind: Den Bewusstseinsupload in „Walkaway“ finde ich auch spannend, allerdings kann ich mich nicht damit anfreunden, dass diese Technologie unter anderem zur Bekämpfung des Klimawandels verwendet werden soll.
Das ist meine Antwort auf die Ideen der grünen Degrowth-Bewegungen. Einer ihrer Grundgedanken ist, dass wir einfach alle sterben sollten, damit es weniger Menschen auf der Welt gibt [lacht]. Wenn wir die Bevölkerungszahl von 7 Milliarden auf 3 Milliarden reduzieren, retten wir den Planeten. Das ist die genozidalste Idee, die ich je gehört habe! Und natürlich müssen wir nach unserem Ableben möglichst umweltschonend verrotten, und die Überlebenden sollten so wenig wie möglich atmen, essen, trinken und sich bewegen. Bruce Sterling nennt das den „Toter-Großvater-Test“: Wenn es deinem toten Opa bessergeht als dir, machst du etwas falsch! [Lacht.] Diese Idee, dass die Menschheit ein Schandfleck ist, führt uns also an einen sehr schlechten Ort. Und auch die Vorstellung mancher grünen Linken, dass wir am besten alle in einer Art Auenland leben sollten, ist verrückt. Wenn man wirklich energie- und ressourceneffizient sein will, packt man alle Menschen in große, vertikal ausgerichtete Städte, in denen die Landwirtschaft in einer kontrollierten Umwelt stattfindet. Kein Bio-Anbau, der massenhaft Land verschlingt, sondern in Gebäuden, in denen wir keine Pestizide mehr brauchen, weil wir Schädlinge aller Art ausfiltern können. So bekommt man unverseuchte Lebensmittel!
Der Schlüssel zu besserer Landwirtschaft und subsequent zu besseren Nahrungsmitteln kann nicht sein, weniger Technologie zu benutzen, sondern mehr. Warum sollte man zum 19. Jahrhundert zurückkehren? Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
Oh ja, absolut! Und es war extrem verschwenderisch! Wenn Sie durch München gehen, sehen Sie allerlei Gebäude aus verschiedenen Zeiten, ja? Aus dem 18. Jahrhundert, und aus den Achtzigerjahren des 20. Jahrhunderts, und ganz neue, und sogar solche, die gerade erst gebaut werden. Wenn Sie eine Grafik erstellen würden, die zeigt, wie viel Material, Energie und Arbeitskraft in jedes dieser Gebäude geflossen ist, würden Sie feststellen, dass der Input konstant fällt, je neuer das Gebäude ist. Daraus könnte man schließen, dass es weiterhin ein stetiges Wachstum geben wird, wenn wir nur lernen, Arbeit, Energie und Material noch effizienter zu nutzen. Aber auch dafür gibt es Grenzen. Das einzige, von dem wir die Grenzen noch nicht ausgelotet haben, sind Netzwerkstrukturen bei der Zuteilung dieser Ressourcen.
Haben Sie eine Bohrmaschine? Es ist eine schlechte Bohrmaschine, oder? Oder haben Sie eine gute?
Mein Stiefvater ist Schreiner. Ich habe kein schlechtes Werkzeug.
[Lacht.] Okay. Die meisten Menschen besitzen eine schlechte Bohrmaschine. Sie ziehen in eine neue Wohnung und hängen endlich die ganzen gerahmten Kunstdrucke auf, und dazu brauchen sie keine gute Bohrmaschine. Danach bohren sie vielleicht ein Loch pro Jahr. Stellen Sie sich vor, dass es statt Tausenden von Leuten, die Tausende von schlechten Bohrern besitzen, unglaublich gute Bohrer gäbe, die wüssten, wann Sie sie brauchen. Sie und die Bohrmaschine finden zueinander, und sobald Sie ihn nicht mehr brauchen, kommt jemand anders, um den Bohrer abzuholen, sodass Sie keinen Platz in der Schublade dafür verschwenden müssten. Das meine ich mit „Zuteilung“.
Wir haben keine Ahnung, wie effizient wir mit so einem Netzwerk werden könnten. Wenn wir es schaffen, das ganze Material, das uns zur Verfügung steht, und unsere effizienten Produktionsmethoden mit einem wirklich effizienten Zuweisungs-Netzwerk, das in Echtzeit arbeitet, zu kombinieren, dann könnten wir vielleicht absoluten Überfluss erreichen. Dann könnten wir vielleicht alles haben, was wir uns vorstellen könnten. Und dann sehen wir all die Dinge, die wir besitzen und die wir nur einmal im Jahr brauchen gar nicht mehr als Reichtum an, sondern als das, was sie wirklich sind: eine Belastung. Wahrer Wohlstand ist, wenn wir das, was wir brauchen, in dem Moment, in dem wir es brauchen, bekommen, und es danach wieder verschwindet.
Könnte man das nicht auch technologisch lösen? Man macht den Bohrer im 3D-Drucker, und sobald man ihn nicht mehr braucht, wird er wieder in Rohstoffe zerlegt, aus denen man neue Sachen herstellen kann.
Das ist eine Idee von Bruce Sterling: Dieses eine Ding, das plötzlich da ist, Daten über seine Nützlichkeit sammelt, sein Design anpasst und sich dann wieder zurück in den Materialstrom begibt, sodass es zu dem Zeitpunkt, an dem es wieder gebraucht wird, neu und besser entstehen kann.
Das klingt wirklich nach einer guten Idee!
Bruce ist eben ein ziemlich schlauer Mensch!
Den zweiten Teil dieses Interviews finden Sie hier.



Kommentare