„Die Reform“
Dmitry Glukhovsky erzählt uns eine Neujahrsgeschichte der etwas anderen Art
Bald ist Silvester, und wir feiern das Ende des alten und den Beginn des neuen Jahres, fragen uns, was es wohl bringen, wie es uns ergehen wird. Wir feiern das Voranschreiten der Zeit – aber für manche steht die Zeit still. Für Russland etwa, das in seiner vermeintlich glorreichen Vergangenheit als Weltmacht schwelgt, und für die Russen, die meinen, dass sie durch eine Wiedergeburt dieser Vergangenheit an Selbstwertgefühl gewinnen. In „Die Reform“ (aus Geschichten aus der Heimat, im Shop) malt sich Dmitry Glukhovsky aus, wie es wäre, wenn die verrückte Obrigkeit die Zeit vollends abschaffen würde – eine Reform, die man am Silvesterabend besonders deutlich zu spüren bekommt …
—
DIE REFORM
»Gut sieht er aus, oder? Frisch«, seufzte Inna.
»Vielleicht eine Aufzeichnung ? Die nehmen das normalerweise vorher auf, beim Fernsehen nennt man das ›Konserve‹«, vermeldete Tanja kennerhaft.
Der Flachbildfernseher reflektierte leicht: Auf dem Bildschirm zeigte sich das Kunststoffkristall des Kronleuchters, vor Mayonnaise stockende Salate, Cellulite-Mandarinen aus dem Kopejetschka-Laden, das stachelige Gold von Lametta. Als habe sich ein schwarzes, rechteckiges Eisloch rasch wieder mit einer hauchdünnen Eisschicht überzogen, die alles spiegelte, was sich auf dieser Seite befand. Und auf der anderen Seite war ein Abgrund. In diesem Abgrund lag die versunkene Stadt Kitesch, erbaut aus rotem und weißem Ziegelstein und aus Dukatengold, und dort rieselte ein nicht irdischer Schnee – gemessen und feierlich, was unter Wasser undenkbar und daher wohl gar kein Schnee war, sondern abgestorbenes, eine Million Jahre altes Plankton; und dort stand ein ergrauender, aber noch nicht völlig ergrauter Mann mit Bratapfelbäckchen und einem schwarzen, sackartigen Mantel. Wie ein Arzt einen unheilbar Kranken ansieht, so schaute er aus dieser tiefen Ewigkeit gütig auf die geschäftigen Wesen diesseits der Eisschicht.
Matwej zog die Nase hoch.
»Früher konnte man es wenigstens anhand der Kremlturmuhr überprüfen. Aber jetzt?«
Vor der Reform hatte es an der Kremlturmuhr Zeiger gegeben, aber dann montierte man sie eines Nachts ab, und es blieben nur die römischen Ziffern zurück, aus denen ein Russe vor allem drei Buchstaben herauslas, deren gängigste Kombination »f*ck« ergab. Ohne Zeiger wirkte die Turmuhr wie ein im Lichtstrahl der Laterne einer Haltestelle erstarrtes Lokomotivrad oder eine verfinsterte, vom schwarzen Schatten im Feuerkranz verschluckte Sonnenscheibe.
»Dann eben scheiß drauf«, sagte Andrej kategorisch, hielt inne, schaute zu den anderen Gästen und präzisierte: »Auf die Kremlturmuhr.«
Der Mann im schwarzen Mantel hielt ein Sektglas in der Hand. Schaute man genauer hin, sah man im blassgelben Glas winzige Bläschen aufsteigen, wodurch es Matwej wie der obere Kolben einer Sanduhr vorkam. Phantomschmerzen, grinste er in sich hinein: Dem Hammer ist alles Nagel.
Vor der Reform hatte Matwej einen guten Job gehabt. Auf dem Kutusowski-Prospekt hatte es drei Uhrenpfandhäuser gegeben, wo Menschen Schweizer Uhren mit Tourbillon oder ohne angekauft oder abgegeben hatten. Diesen Menschen ging es damals zu ihrer eigenen Überraschung auf einmal viel zu gut, weshalb sie ständig einen Beweis für die Echtheit dieses Wunders bei sich tragen wollten, bis es ihnen wieder schlecht zu gehen begann und sie gezwungen waren, diesen Beweis in Geld zurückzuverwandeln. Von solchen Leuten waren auf dem Kutusowski-Prospekt so einige unterwegs gewesen. Genau dort verlief eine wichtige Verkehrsader auf der topografischen Karte ihres Schicksals. Matwej hatte in einem dieser Pfandhäuser gearbeitet und dort einen guten Stand gehabt.
Seine Aufgaben waren die Annahme von Uhren, ihre Schätzung (und Unterschätzung) sowie die Justierung und die Reparatur rheumatischer Tourbillons gewesen, sodass die Uhren nach einer Neubewertung an die nächste Generation von Neureichen weiterverkauft werden konnten, die gerade erst auf den aufsteigenden Ast gekommen und daher noch bereit waren, sich vorerst mit fremden Uhren zu begnügen. Infolge der natürlichen Auslese und der Verringerung der Ressourcen hatte es immer weniger Menschen gegeben, denen das gelungen war. Aber es waren neue auf die Welt gekommen mit denselben Begierden und Verhaltensklischees wie ihre Vorgänger, deswegen hatte der Handel nicht nachgelassen.
Einige ruinierten sich gründlich, und vor ihrer Verwandlung in Planktonsuppe hatten sie die ihnen einst ausgehändigten Insignien den Geldverleihern überlassen und vielleicht Trost bei dem Gedanken gefunden, die Tourbillon-Uhren könnten doch noch zurückgedreht und die Dinge wieder besser werden. Doch der Lauf der Zeit und die damit verbundenen Evolutionsgesetze waren unerbittlich, und nie war jemand gekommen, um sich seine Uhr zurückzuholen.
Dafür kamen andere, um sich fremde Uhren zu holen.
Mit scharfem Geierblick und der feinen Nase eines Schakals, stets auf ihren eigenen Vorteil bedacht, hatten sie für jede von einem menschlichen Wesen auf dem teuren Schweizer Uhrwerk hinterlassene Spur, für jeden Beweis, dass diese Uhr ihre Unschuld einem anderen überlassen und bereits die Sekunden eines fremden Lebens gezählt hatte, den Preis so weit wie möglich heruntergehandelt. Als ob sie das in irgendeiner Weise in Verruf hätte bringen können!
Vorbei war die Ära der Rohstoff-Gangster, zu Ende ging die Epoche der Etat-Schmarotzer, es brach die Periode der epikureischen Opritschniks an. Die Epochen fossilierten immer schneller, aber Matwej hatte stets an die Zukunft geglaubt: Nach den Opritschniks kämen andere Epikureer, denn in Russland waren der Epikureismus und das Bedürfnis, sich der Echtheit eines Wunders zu versichern, zu allen Zeiten unerschütterlich geblieben und würden während des Wechsels der Aushängeschilder an der Fassade des Imperiums und der Ikonen in den Amtsstuben auch weiterhin alles unter sich begraben.
Und dann kam die Reform.
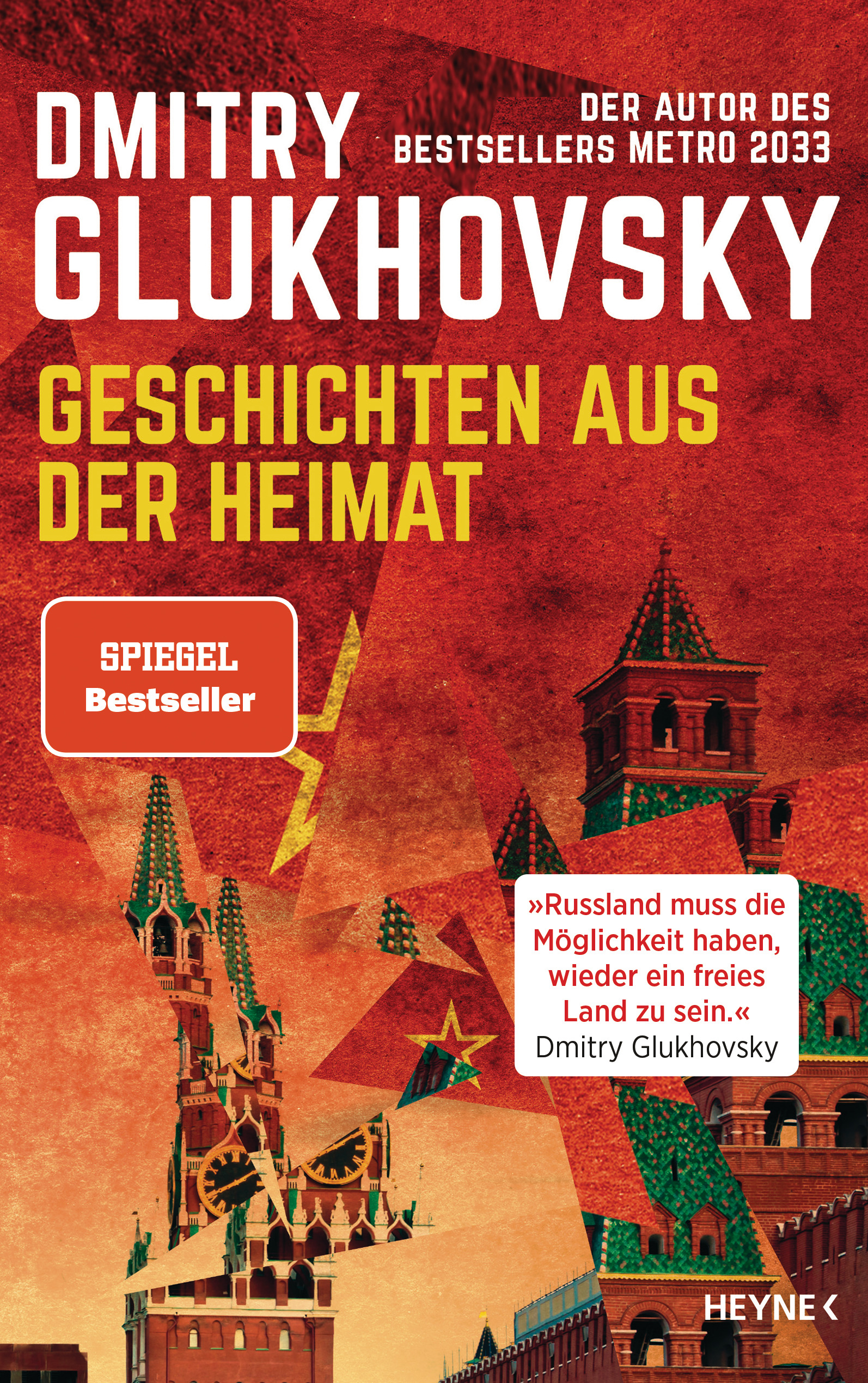 Man konnte nicht sagen, sie wäre wie ein Blitz aus heiterem Himmel gekommen, denn in gewissem Sinne waren die Dinge auf sie hinausgelaufen. Wäre Matwej etwas weniger optimistisch gewesen oder seiner Arbeit etwas weniger leidenschaftlich nachgegangen, und hätte er seinen Blick, der durch das Lupenmonokular auf das Drehen der Uhrenzahnräder gerichtet gewesen war, mit derselben Aufmerksamkeit auf die Mechanismen gelenkt, die den russischen Makrokosmos steuerten, dann hätte er rechtzeitig bemerken können, dass sich die gigantischen Zahnräder dieser Welt knirschend verlangsamten. Er hätte sich rechtzeitig absichern können wie seine Kollegen aus den beiden anderen Uhrenpfandhäusern, die sich damals auf den Verleih von Schmuck verlegten, zumal der in Russland auch jetzt nicht verboten war und ebenso nach einem Wechsel von Fingern und Hälsen verlangte wie zuvor die Uhren nach immer neuen Handgelenken.
Man konnte nicht sagen, sie wäre wie ein Blitz aus heiterem Himmel gekommen, denn in gewissem Sinne waren die Dinge auf sie hinausgelaufen. Wäre Matwej etwas weniger optimistisch gewesen oder seiner Arbeit etwas weniger leidenschaftlich nachgegangen, und hätte er seinen Blick, der durch das Lupenmonokular auf das Drehen der Uhrenzahnräder gerichtet gewesen war, mit derselben Aufmerksamkeit auf die Mechanismen gelenkt, die den russischen Makrokosmos steuerten, dann hätte er rechtzeitig bemerken können, dass sich die gigantischen Zahnräder dieser Welt knirschend verlangsamten. Er hätte sich rechtzeitig absichern können wie seine Kollegen aus den beiden anderen Uhrenpfandhäusern, die sich damals auf den Verleih von Schmuck verlegten, zumal der in Russland auch jetzt nicht verboten war und ebenso nach einem Wechsel von Fingern und Hälsen verlangte wie zuvor die Uhren nach immer neuen Handgelenken.
Für den Paradigmenwechsel ließ man dem Volk kein bisschen Zeit: Innerhalb eines Tages wurde die Reform in beiden Kammern der Föderalen Versammlung beschlossen, und sofort rasten UAZ-Geländewagen von der Farbe einer Sommernacht und mit roten Streifen durch die Straßen. Ihnen entstiegen Männer mit Sturmhauben und Schulterstücken, und in allen Uhrengeschäften, Werkstätten und Pfandhäusern ertönten gleichzeitig die Türklingeln. Die Händler, Geldverleiher und einfachen Uhrmacher konnten kaum »Ach !« rufen, da war alles schon wieder vorbei. Der gesamte, unverkaufte Bestand an Uhren wurde zugunsten des Staates beschlagnahmt, und der Staat verfügte dann nach eigenem Ermessen darüber; verwandelte ihn offenbar in Devisen und nährte damit seiner Gewohnheit entsprechend die Armen.
Die Übrigen bekamen eine Woche Zeit, um sich aller Uhren zu entledigen, sowohl der mechanischen als auch der elektronischen, wobei diese in speziellen Behältern gesammelt wurden, die an jeder Metrostation aufgestellt worden waren. Wer es innerhalb der ersten Woche nicht geschafft hatte, seine Uhr zu entsorgen, dem drohte im ersten Monat eine Ordnungsstrafe, später dann schon ein Strafverfahren. Es kam sogar zu zwei aufsehenerregenden Gerichtsprozessen: einer gegen einen oppositionellen Aktivisten, der andere gegen einen vollgefressenen Kleptokraten. Beide standen nun nicht nur wegen ihres obstinaten Willens, dem Vaterland zu schaden, auf einer Stufe, sondern auch aufgrund ihres obstinaten Unwillens, eine nutzlose, veraltete Gewohnheit aufzugeben, die eigentlich nur Trägheit war und die alle anderen leichten Herzens abgelegt hatten.
Vergessen wurden die Sekunden, vergessen wurden die Minuten, sogar die Stunden wurden vergessen, obwohl die Menschen vorerst noch versuchten, sie am Sonnenstand zu erraten. Doch dann hieß es nur noch mittags, morgens, abends; nur war es im Winter schwierig, den Morgen vom Abend zu unterscheiden, deswegen wurde dafür ein einfacherer Ausdruck gefunden – »damals« und »nachher«. Und das bürgerte sich leicht ein und wurde fruchtbar, denn es ebnete den Weg für den nächsten Teil der Reform: die Abschaffung des Kalenders.
Einige nostalgische Relikte waren geblieben, wie etwa jetzt die Neujahrsansprache im Fernsehen, anhand derer man immerhin noch die Jahre zählen konnte. Aber auch das hatte eine Kehrseite, deswegen standen, wie Tanja verriet, die Neujahrsansprachen ebenfalls vor dem Aus: Auch sie sollten abgeschafft werden, weil sie Kerben ins lebendige Gewebe einer großen Zeit schnitten. Dieser auch nur in Gedanken Schnitte zuzufügen war schon Blasphemie.
»Trotzdem verstehe ich nicht, ob das wirklich nötig war.«
Erneut zog Matwej die Nase hoch und polierte seine Brille mit einem löchrigen Taschentuch.
»Als wäre er jünger geworden«, seufzte Inna.
—
Dmitry Glukhovsky: Geschichten aus der Heimat • Erzählungen • Aus dem Russischen von David Drevs, Christiane Pöhlmann und Franziska Zwerg • Wilhelm Heyne Verlag, München 2022 • ca. 460 Seiten • Hardcover • 24,– (im Shop)



Kommentare