Willkommen in einer besseren Welt!
Eine zweite Leseprobe aus Cory Doctorows brandneuem Meisterwerk „Walkaway“
„In Zeiten, in denen Dystopien den Buchmarkt überschwemmen und sich niemand mehr eine positive Veränderung vorstellen kann, ist Cory Doctorows Utopie eine literarische Sensation“, sagte Kim Stanley Robinson über „Walkaway“ (im Shop). Doch nicht nur seine Schriftstellerkollegen sind begeistert von Cory Doctorows jüngstem Werk, auch die Presse preist den Roman in den höchsten Tönen. So schrieb das GQ Magazine beispielsweise Cory Doctorows „Blick in die Zukunft ist keine spröde Theorie, sondern packende (und von Edward Snowden gelobte) Sci-Fi mit Witz.“ Und Deutschland Funk Kultur urteilte: „Eine spannende Story, die zudem lehrreich ist!“
Wenn Sie den Roman noch nicht kennen und jetzt neugierig geworden sind, haben wir hier für Sie eine Leseprobe zum Hineinschnuppern.
Sonntags war im Belt and Braces immer am meisten los, und es herrschte ein Konkurrenzkampf um die besten Jobs. Der Erste, der durch die Tür trat, schaltete das Licht ein und überprüfte die Infografiken. Sie waren leicht zu lesen, jeder konnte sie verstehen, sogar die Noobs. Aber Limpopo war kein Noob. Sie hatte mehr Commits in die Firmware des Belt and Braces eingebracht als jeder andere. Eine ganze Größenordnung mehr als die anderen. Genau genommen gehörte es sich nicht, die eigenen Commits zu zählen, ganz zu schweigen davon, so genau Buch zu führen. In einer Schenkökonomie gab man alles weg, ohne es genau aufzulisten, denn wenn man es auf- listete, bedeutete dies, dass man eine Belohnung erwartete. Wenn man etwas für eine Belohnung tat, war es eine Investition und kein Geschenk.
Theoretisch stimmte Limpopo damit überein. In der Praxis war es dagegen sehr leicht, die Beiträge zu zählen, und die Bestenliste war so befriedigend, dass sie einfach nicht anders konnte. Sie war nicht stolz darauf. Meistens jedenfalls. Aber als sie an diesem Sonntag als Erste durch die Tür des Belt and Braces trat, allein in dem großen Gemeinschaftsraum mit den ordentlich aufgestellten Tisch- und Stuhlreihen stand und auf allen Infografiken normale Werte sah, da war sie stolz. Mit einem perversen, völlig inakzeptablen Besitzerstolz tätschelte sie die Wand. Sie hatte geholfen, das Belt and Braces aufzubauen. Sie hatte im Ödland die Teile beschafft, die die Kundschafterdrohnen als notwendig für die Konstruktion markiert hatten. Dies war das Projekt, das sie zur Walkaway gemacht hatte. Die Sache, an die sie vor allem gedacht hatte, als sie durchs Ödland gewandert war. Sie hatte den Rucksack abgestellt, alles aus den Taschen genommen, was sich zu stehlen gelohnt hätte, Reserveunterwäsche in einen Beutel gestopft und war zum Steilhang am Niagara gewandert, vorbei an der unsichtbaren Grenze zwischen der Zivilisation und dem Niemandsland, hinaus aus der Welt, wie sie war, und hinein in die Welt, wie sie sein konnte.
Die Grundlage des Codes stammte vom UN-Flüchtlingskommissariat und war in der Praxis gründlich erprobt worden. Man sagte dem Programm, was für ein Gebäude man haben wollte, teilte ihm ein Gebiet für die Beschaffung zu und wies die Drohnen an, alles in der Nähe zu inventarisieren, scannte alles auf mehreren Frequenzbändern, durchforstete die Datenbanken nach Unterlagen der Stadtplaner und Bauämter und suchte brauchbare Stoffe für das, was man eben bauen wollte. Danach begann das Sammeln. Die Flüchtlinge oder Hilfsarbeiter (in schändlichen Ausnahmefällen auch die eingekauften jugendlichen Sklaven) schwärmten aus und holten die Stücke, die das Gebäude brauchte, um sich selbst aus dem Hut zu zaubern.
Die Stoffe wurden zum Bauplatz befördert. Das Gebäude überwachte, konfigurierte sie und hielt den zeitkritischen Bauplan auf dem Laufenden, wobei die Fertigkeiten der Arbeiter oder Roboter jederzeit einkalkuliert wurden. Was dort geschah, wirkte einerseits wie Zauberei und andererseits wie rituelle Demütigung. Wenn man etwas falsch installierte, versuchte das System, einen Weg zu finden, den dummen Fehler zu umgehen. Falls das nicht möglich war, gab das System mit zunehmender Intensität haptische Signale aus. Wenn man sie ignorierte, folgten optische und sogar akustische Reize. Unterdrückte man auch diese Hinweise, erzählte es den anderen Menschen, dass etwas falsch lief, und instruierte sie, die Sache in Ordnung zu bringen. Es hatte eine Menge A/B-Splittests gegeben – sie waren für jeden sichtbar bereits im Code und in den Prüfroutinen angelegt –, und die Gebäude hatten mit der Zeit herausgefunden, dass die erfolgreichste Strategie für die Korrektur menschlicher Fehler darin bestand, die Menschen zu ignorieren.
Wenn man eine Stahlstrebe auf eine Weise einbaute, mit der das Gebäude absolut nichts anfangen konnte, und den anschwellenden Chor der Warnungen ignorierte, bekam jemand anders die Mitteilung, ein Stück Baumaterial sei »fehlgeleitet« worden, und dazu eine Aufforderung mit hoher Dringlichkeit, es zu entfernen. Genau die gleiche Fehlermeldung warfen die Gebäude aus, wenn etwas verrutscht war. Die Fehlerroutine unterstellte nicht etwa, dass ein Mensch aus Böswilligkeit oder Unfähigkeit Mist gebaut hatte. Ursprünglich war die Theorie davon ausgegangen, dass ein Fehler, für den es keinen Verantwortlichen gab, sozial verträglicher war. Die Menschen schämten sich für Fehler und besonders für diejenigen, die sie vor den Augen ihrer Artgenossen machten. Die alternative Routine, bei der Verantwortliche gesucht und Namen genannt wurden, hatte zu der Erkenntnis geführt, dass rotwangige Verleugnung das größte Hindernis bei der Fertigstellung eines Gebäudes war.
Wenn also etwas in die Hose ging, tauchte bald jemand anders mit einem Mech, einem Gabelstapler oder einem Schraubenzieher und dem Auftrag auf, das Teil in Ordnung zu bringen, das jemand mit roher Gewalt an eine Stelle setzen wollte, an die es nicht gehörte. Man konnte so tun, als wäre man mit der gleichen Arbeit beauftragt wie der neue Mann, und sich als Teil der Lösung statt als Ursache des Problems darstellen. Das half den Menschen, das Gesicht zu wahren, sodass man nicht darauf beharrte, alles richtig gemacht zu haben, während das Gebäude mit seinen dummen Anweisungen (und alles andere im Universum) völlig falsch lag.
Die Realität war auf eine Art und Weise, die Limpopo liebte, viel zäher und verrückter. Wenn man ausgesandt wurde, um etwas zu entbosseln und auf jemanden stieß, der offensichtlich die Quelle der Verbosselung war, konnte man sofort erkennen, dass die stählerne Stützstrebe nicht um drei Grad schief stand, weil es einen Schlupf gab, sondern dass sie um drei Grad vom rechten Winkel abwich, weil ein Vollpfosten es verpfuscht hatte. Außerdem wusste Señor Vollpfosten, dass man wusste, dass es seine Schuld war. Aber der Auftrag lautete: STÜTZSTREBE 3 AUF 120° NNO DRINGEND KORREKT AUSRICHTEN, statt: STÜTZSTREBE 3 AUF 120° NNO DRINGEND KORREKT AUSRICHTEN, WEIL EIN VOLL- PFOSTEN DIE ANWEISUNGEN NICHT LESEN KANN.
Das erlaubte es den Beteiligten, ein manierliches Kabuki aufzuführen und in der dritten Person zu sprechen: »Diese Strebe steht nicht lotrecht«, statt: »Du hast die Strebe falsch eingebaut.«
Diese Heuchelei – Forscher nannten sie »zielorientierte soziale Ignoranz«, während andere vom »Ja, wie ist das denn passiert?«-Effekt sprachen – führte zu einer deutlichen Neuorientierung des UNHCR-Notunterkunftprogramms. Vorher hatte man die Projekte gamifiziert und war gescheitert, es hatte Bestenlisten für die gelungensten Installationen und die erfolgreichsten Materialsammler gegeben. Die Testbauten gingen mit wütendem Streit und Faustkämpfen einher. Auch das war schon ein Fortschritt, weil jede Projektgruppe gewöhnlich sehr schnell in zwei oder drei Untergruppen zerfiel, die jeweils eigene Gebäude hochzogen. Drei zum Preis von einem! Leider waren die aufgesplitterten Projekte nicht ganz so ehrgeizig formuliert wie der ursprüngliche Bauplan.
Die frühen Versuche hatten ein charakteristisches Aussehen: ein weitläufiges, flaches und niedriges Gebäude. Die ersten drei Stockwerke eines Bauwerks, das für zehn geplant worden war, ehe die Hälfte der Arbeiter aufgegeben hatte. Hundert Meter entfernt verkörperten drei weitere Gebäude, jeweils halb so groß wie das ursprüngliche, die ersten und zweiten Abspaltungen und den Rachebau der zerstrittenen Abtrünnigen. Mancherorts waren Fibonaccispiralen immer kleinerer Abspaltungen zu sehen, die in einem Feindseligkeit ausstrahlenden Gartenhäuschen endeten.
Die Gebäude vollzogen den Sprung von den Blaupausen der UNHCR zu den Walkaways und mutierten zu unzähligen Varianten, die weit über das ursprüngliche Pantheon von Kliniken, Schulen und Flüchtlingsunterkünften hinausgingen. Das Belt and Braces war der erste Gasthof, an dem sich überhaupt irgendjemand versucht hatte. Das Layout einer Restaurantküche unterschied sich nicht sehr stark von dem einer Lagerküche, und auch die großen Gemeinschaftsräume waren kein Problem. Allerdings war der Zeitgeist ein deutlich anderer, und der ursprüngliche Bauplan wurde tausendfach geändert, bis niemand mehr eintreten und sagen konnte: »Das ist eine Flüchtlingsunterkunft, die jemand zu einem Restaurant umgemodelt hat.«
Andererseits konnte man das Belt and Braces keinesfalls mit einem normalen Restaurant verwechseln. Der wichtigste Einrichtungsgegenstand war die projektionsfähige Beleuchtung, die mit angenehmen roten und grünen Farbtönen Flächen und Objekte anstrahlte, um die Menschen auf Dinge hinzuweisen, die ihrer Aufmerksamkeit bedurften. Das entsprach ganz und gar den Vorgaben der UNHCR, aber natürlich war es ein großer Unterschied, ob man Militärrationen an Klimaflüchtlinge verteilte oder hübsche Trockeneiscocktails mit Alkoholpulver aus dem Feuchtdrucker herstellte. So viele Cocktailschirmchen und anmutige Sektquirle gab es in keinem Flüchtlingslager.
An einem durchschnittlichen Tag bediente das Belt and Braces zweihundert Gäste. An Sonntagen waren es eher fünfhundert. Der Zustrom an Noobs brachte Talentsucher, Sexualpartner, Band- und Bettgefährten und natürlich Täter und Opfer zusammen. Da Limpopo als Erste durch die Tür trat, durfte sie die Rolle des Zeremonienmeisters beanspruchen. Die Anzeigen verrieten ihr, dass das Bier am vergangenen Abend gut gelaufen war. Die Brennstoffzellen waren zu 45 Prozent geladen und konnten das Belt and Braces zwei Wochen lang mit Energie versorgen. Die Propeller auf den Dächern hatten sich eifrig gedreht, Abwasser durch Elektrolyse aufgespalten und den Wasserstoff in die Zellen gepumpt. Im Keller befanden sich fünfzig Brennstoffzellen, geborgen aus aufgegebenen Düsenflugzeugen, die die Drohnen geortet hatten. Die Jets waren nicht lange geflogen, hatten aber dem Belt and Braces viel Material geliefert, darunter Dutzende Passagiersitze, die jetzt als Bänke dienten. Die strapazierfähigen Sitzbezüge waren sauber, und die schmutzabweisenden Oberflächen zeigten bei jedem Wischer mit dem Lappen die Muster, als hätte man Zaubertinte sichtbar gemacht.
Die Brennstoffzellen waren die größte Entdeckung überhaupt gewesen. Ohne sie wäre das Belt and Braces ganz anders geworden. Es hätte immer wieder Stromausfälle und Spannungsschwankungen gegeben. Limpopo fürchtete, sie könnten gestohlen werden; sie musste sich sehr beherrschen, um die Zugangsluken nicht mit Überwachungseinrichtungen zu sichern.
Obwohl die Kennlichter der Vorräte im Lager grün waren, schnüffelte sie persönlich an den Käsekulturen und stocherte im Teig herum. Die Soßenvorprodukte rochen lecker, und die Eismaschine kühlte träge summend das Speiseeis. Sie bestellte Coffium und setzte sich mitten in den großen Raum, wo sie ein Lichtstrahl aufspießte, während der fruchtige, rauchige Duft hereinwehte.
Die erste Tasse Coffium tanzte heiß in ihrem Mund, und die Welle der Inhaltsstoffe sickerte durch die Schleimhäute unter der Zunge in den Kreislauf. Die Fingerspitzen und die Kopfhaut kribbelten. Sie schloss die Augen, um die Wirkung der zweiten Welle von Aromastoffen zu genießen, während ihr Magen die Arbeit aufnahm. Ihr Gehör wurde schärfer, die großen Muskeln in Beinen, Armen und Schultern brannten, als wollte sie nach viel zu langer Untätigkeit endlich tanzen. Sie trank noch einen großen Schluck und schloss die Augen. Als sie sie wieder öffnete, hatte sie Gesellschaft.
Es waren fürchterliche Noobs, die aussahen, als wären sie direkt aus der Castingagentur gekommen. Noch schlimmer, sie waren echte Schlepper mit ihren übergroßen schweren Rucksäcken, den Trekkingjacken mit den vielen Taschen und den vollgestopften Cargohosen. Sie wirkten aufgeplustert. Die meisten Schlepper waren neurotisch, gaben binnen weniger Wochen auf und ließen eine dampfende zwischenmenschliche Müllkippe zurück. Limpopo war auf die richtige Weise weggegangen. Sie hatte nichts als saubere Unterwäsche mitgenommen, und selbst die wäre überflüssig gewesen. Sie versuchte, ihre Vorurteile gegenüber diesen dreien zurückzustellen, zumal sie gerade die schwindligen ersten fünf Minuten des Coffiumrauschs genoss. Sie wollte nicht hart sein, wenn ihr nach Sanftmütigkeit war.
»Willkommen im B and B«, rief sie lauter als beabsichtigt. Die drei zuckten zusammen und rafften sich auf.
»Hallo.« Das Mädchen trat einen Schritt vor. Sie trug schöne Kleidung, der Stoff war im Schrägschnitt zerteilt und im Versatz vernäht. Limpopo mochte es. Später würde sie das Bild des Mädchens aus dem Archiv holen, die Muster analysieren und ein Stück für sich selbst herstellen. Alle, die es sahen, würden sie beneiden, bis der Schnitt die Runde machte und langweilig wurde. »Tut mir leid, dass wir einfach so hereinplatzen, aber wir haben gehört …«
»Ihr habt richtig gehört.« Limpopo sprach jetzt leiser, aber immer noch zu laut. Entweder musste die Wirkung des Coffiums abklingen, bis sie sich besser unter Kontrolle hatte, oder sie musste erheblich mehr trinken, bis es ihr egal war. Sie drückte auf »Nachfüllen« und stellte den Becher unter die Düse. »Wir haben täglich rund um die Uhr für jedermann geöffnet, aber die Sonntage sind etwas Besonderes, denn dann begrüßen wir die neuen Nachbarn und lernen sie kennen. Ich bin Limpopo. Wie wollt ihr genannt werden?«
Diese Formulierung war für die Walkaways typisch. Es war eine ausdrückliche Einladung, sich neu zu erfinden. Jeder Walkaway, der etwas auf sich hielt, begrüßte andere Menschen auf diese Weise. Limpopo benutzte die Formulierung ganz bewusst, weil sie erkannte, dass die drei unter großer Anspannung standen.
Der kleinere der beiden Männer, er hatte einen zotteligen, verfilzten Bart und einen Stoppelhaarschnitt, streckte die Hand aus. »Ich bin Gizmo von Puddleducks, das ist Zombie McDingleberry, und das ist Etcetera.« Die anderen beiden verdrehten die Augen.
»Danke, Gizmo, aber eigentlich kannst du mich ›Stabile Strategie‹ nennen«, erklärte das Mädchen.
Der andere Mann, groß, aber vorgebeugt, mit einem eulenhaften Aussehen und Falten der Erschöpfung im Gesicht, seufzte. »Meinetwegen, dann bin ich eben Etcetera. Vielen Dank, Herr von Puddleducks.«
»Freut mich«, antwortete Limpopo. »Legt doch eure Sachen ab, setzt euch und trinkt etwas Coffium.«
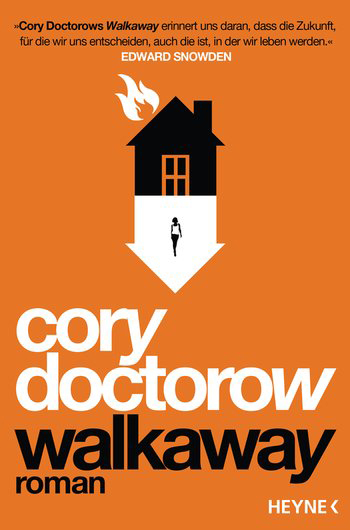 Die drei wechselten Blicke, Gizmo zuckte mit den Achseln und sagte: »Ja, warum nicht?« Er schüttelte sich und ließ den Rucksack herunterrutschen. Der Packen fiel mit einem lauten Plumps auf den Boden. Limpopo zuckte zusammen. Teufel auch, was schleppen diese Noobs eigentlich über Stock und Stein mit? Ziegelsteine?
Die drei wechselten Blicke, Gizmo zuckte mit den Achseln und sagte: »Ja, warum nicht?« Er schüttelte sich und ließ den Rucksack herunterrutschen. Der Packen fiel mit einem lauten Plumps auf den Boden. Limpopo zuckte zusammen. Teufel auch, was schleppen diese Noobs eigentlich über Stock und Stein mit? Ziegelsteine?
Die anderen beiden folgten seinem Beispiel. Das Mädchen zog die Schuhe aus und rieb sich die Füße. Die anderen taten es ihr gleich. Limpopo rümpfte die Nase, als sie die verschwitzten Füße roch, und nahm sich vor, ihnen bald die Sockenausgabe zu zeigen. Dann zapfte sie drei Coffium und benutzte dabei die hauchdünnen Keramiktassen, die mit gewundenen, grifffesten Mustern verziert waren. Sie stellte die Tassen auf Untertassen und legte kleine Möhrenbiskuits und etwas eingelegten Rettich dazu. Dann brachte sie alles auf einem Tablett, das in einer Aussparung andocken konnte, an den Tisch der Noobs. Schließlich hob sie ihren großen Pott. »Auf die ersten Tage einer besseren Welt.« Auch das war eine kitschige Redensart der Walkaways, aber der Sonntag war der Tag für kitschige Walkaway-Sprüche.
»Die ersten Tage«, erwiderte Etcetera mit überraschender und entsetzlicher Aufrichtigkeit.
»Erste Tage«, stimmten die anderen beiden ein und stießen an. Sie tranken und blieben still, während die Wirkung einsetzte. Das Mädchen grinste wie die Katze, die den Kanarienvogel gefressen hatte, atmete kurz und lautstark ein und richtete sich bei jedem Atemzug weiter auf. Die beiden anderen ließen sich äußerlich nicht so viel anmerken, doch auch ihre Augen glänzten. Limpopos eigene Dosis war jetzt optimal, und auf einmal wollte sie diese Noobs so freundlich wie möglich willkommen heißen. Sie sollten sich großartig und zuversichtlich fühlen.
»Wollt ihr einen Brunch? Es gibt Waffeln mit echtem Ahornsirup, Eier nach Wunsch zubereitet, etwas Schweinebauch und Hähnchenbrust. Ich bin ziemlich sicher, dass auch Croissants da sind.«
»Können wir dir dabei helfen?«, fragte Etcetera.
»Keine Sorge, bleibt einfach sitzen und lasst das alles auf euch wirken. Das Belt and Braces kümmert sich um euch. Später können wir sehen, ob wir einen Job für euch finden.« Sie verschwieg, dass sie noch viel zu grün waren und sich ganz sicher noch nicht das Recht verdient hatten, im B&B auszuhelfen. Im Umkreis von fünfzig Kilometern rissen sich die Walkaways darum, im Belt and Braces zu arbeiten und demütigst damit zu prahlen. Die Küche im B&B konnte sowieso alles selbstständig erledigen. Limpopo hatte eine ganze Weile gebraucht, um zu begreifen, dass Essen angewandte Chemie war und dass Menschen beschissene Labortechniker waren, doch wie John Henry musste sie zugeben, dass das B&B mit seinen automatisierten Systemen das beste Essen produzierte, wenn die Menschen möglichst wenig eingriffen. Außerdem gab es Croissants, und das war aufregend!
Die Orangen presste sie allerdings persönlich aus, aber nur weil sie es so sehr mochte, die Hände einzusetzen und die Muskeln in den Schultern und Armen zu bewegen, wenn ihr Rausch auf dem Höhepunkt war. Sie quetschte die Orangen fast so sauber aus wie die Maschine. Es waren sowieso blaue Orangen, optimiert für den Gewächshausanbau im Norden, die ihren Saft bereitwillig hergaben. Sie verteilte alles auf Teller – wenigstens das war etwas, in dem die Menschen sich hervortun konnten – und servierte es.
Als sie die Küche verließ, waren noch weitere Noobs eingetroffen. Einer von ihnen war dem Hitzschlag nahe und musste medizinisch versorgt werden. Sie hatte ihn sich gerade vorgenommen – Coffium war wundervoll, um gelassen zu bleiben, wenn man so viele Dinge gleichzeitig erledigen musste –, da trafen die Helfer ein und kümmerten sich routiniert darum, allen ihre Plätze zuzuweisen und sie mit Essen zu versorgen. Es dauerte nicht lange, bis im B&B ein stetiges Kommen und Gehen herrschte, dessen Rhythmus Limpopo liebte wie kaum etwas anderes. Das Summen eines komplexen anpassungsfähigen Systems, in dem Menschen und Software nebeneinander in einem Zustand existierten, den man nur als Tanz bezeichnen konnte.
Je nach Material, das die Gäste im Laufe des Tages mitbrachten, änderte sich auch die Speisekarte. Limpopo knabberte Reste und wechselte von einem roten Licht zum nächsten, bis sie wieder grün wurden. Sie hatte beinahe einen sechsten Sinn entwickelt, der ihr sagte, wo mit dem nächsten roten Licht zu rechnen war, und nahm mehr als den vorgesehenen Anteil an Arbeitseinheiten auf sich. Hätte es an diesem Tag im B&B eine Bestenliste gegeben, dann hätte sie zu ihrer großen Verlegenheit einsam an der Spitze gestanden. Sie gab sich große Mühe, ihren Freunden nicht zu zeigen, wie emsig sie tatsächlich beschäftigt war. Die Geschenkökonomie sollte kein karmisches Kassenbuch sein, in dem eine Spalte die guten Taten und die andere die Belohnungen auflistete, die man dafür einheimsen durfte. Der Lebenssinn der Walkaways war es, im Überfluss zu leben, und im Überfluss musste man sich nicht darum kümmern, ob man genauso viel leistete, wie man sich herausnahm. Aber es gab durchaus Schmarotzer, und an Arschlöchern, die sich immer die besten Sachen nahmen und durch Gedankenlosigkeit alles ruinierten, herrschte kein Mangel. Das entging den Mitmenschen keineswegs. Arschlöcher wurden nicht zu Partys eingeladen, niemand zeigte große Bereitschaft, sich um sie zu kümmern. Auch ohne Kassenbuch gab es eine Art Abrechnung, und Limpopo wollte für alle Fälle ein paar gute Wünsche und etwas gutes Karma ansparen.
Um vier Uhr nachmittags ließ der Andrang nach. Es gab so viele leicht verderbliche Speisen, dass das B&B zur Feier des Tages für den Nachmittag kurzfristig eine Teestunde ausrief. Limpopo folgte den roten Zonen in der Zubereitung und entdeckte Etcetera.
»Hallo, wie gefällt dir dein Noob-Tag hier im wundervollen Belt and Braces?«
Er zog den Kopf ein. »Ich fühle mich, als würde ich gleich explodieren. Ich habe gegessen, Drogen genommen, Alkohol getrunken und am Feuer ein Nickerchen gemacht. Ich kann nicht mehr herumsitzen. Teile mich doch bitte zur Arbeit ein.«
»Ist dir klar, dass du so etwas nicht sagen darfst?«
»Diesen Eindruck hatte ich schon. Ihr seid irgendwie seltsam – oder sind wir es? –, wenn es um Arbeit geht. Man soll seinen Job nicht besonders lieben, und man soll nicht auf Faulpelze herabschauen, man soll nicht jemanden vergöttern, der sich sehr ins Zeug legt. Soll das eine selbstregulierende natürliche Homöostase sein?«
»Ich dachte mir schon, dass du klug bist. Genau das ist es. Wenn du jemanden fragst, ob du helfen kannst, dann gibst du ihm damit zu verstehen, dass er die Verantwortung trägt und dass du dich seiner Autorität unterordnest. Beides ist verpönt. Wenn du arbeiten willst, dann tu etwas. Wenn es nicht hilfreich ist, mache ich es später vielleicht rückgängig, oder wir reden darüber oder vergessen es. Es ist passiv-aggressiv, aber so ist es bei den Walkaways. Hier hat es niemand eilig.«
Das musste er erst einmal verdauen. »Wirklich? Gibt es wirklich diesen Überfluss? Wäre immer noch genug da, wenn morgen die ganze Welt in den Walkaway ginge?«
»Laut Definition ist das so«, antwortete sie. »Denn genug ist, was du als genug bezeichnest. Vielleicht willst du dreißig Kinder haben. Dann ist ›genug‹ für dich mehr als für mich. Vielleicht willst du deine Kalorien auf eine sehr spezifische Weise zu dir nehmen. Vielleicht willst du an einem ganz bestimmten Ort leben, wo auch viele andere leben wollen. Je nachdem, wie du die Sache betrachtest, ist es niemals genug, oder es herrscht immer ein Überfluss.«
Während sie redeten, machten drei andere Walkaways Tee, bereiteten Scones, leckere Sandwichs und dampfende Pötte vor und stellten die Zutaten auf Tabletts. Bewusst schob sie das unschöne Gefühl beiseite, jemand anders erledigte »ihren« Job. Solange der Job erledigt wurde, spielte das keine Rolle. Falls überhaupt etwas eine Rolle spielte. Trotzdem war es ihr wichtig, wenngleich nicht mit Blick auf die großen Zusammenhänge. Ihr wurde bewusst, dass sie in einer ihrer Schleifen gelandet war.
»Damit wäre das erledigt.« Sie nickte in Richtung der Helfer, die die Tabletts nach draußen trugen. »Lass uns essen.«
»Ich glaube, ich kann nicht mehr.« Er tätschelte seinen Bauch. »Ihr solltet ein Vomitorium einrichten.«
»Die sind bloß eine Legende«, erklärte sie. »Ein ›Vomitorium‹ ist nur ein Engpass zwischen zwei Kammern, aus dem eine Menschenmenge hervorquillt. Das hat nichts damit zu tun, sich den Finger in den Hals zu stecken und sich in kollektiver Bulimie zu üben.«
»Trotzdem.« Er machte eine nachdenkliche Miene. »Ich könnte eins installieren, oder? Ich könnte mich in deine Benutzeroberfläche einloggen, einen Entwurf skizzieren, mich nach Material umsehen, Ruinen zerlegen und Ziegelsteine herausklopfen?«
»Technisch gesehen schon, aber ich glaube, dabei würdest du keine Hilfe bekommen, und es gäbe sogar Rückbauten, wenn du nicht da bist. Die Leute würden die Ziegelsteine wegnehmen und alles wieder abbauen. Ich meine, ein Vomitorium ist nicht nur apokryph, sondern auch widerlich. So etwas gibt es in der Praxis nicht.«
»Aber wenn ich eine Bande Trolle hätte, dann könnten wir es tun, oder? Ich könnte ja bewaffnete Wächter aufstellen, Eintritt nehmen und Big Macs produzieren, oder?«
Es war eine ermüdende Noob-Diskussion. »Ja, das könntest du. Wenn du dich damit halten könntest, dann würden wir ein Stück die Straße hinunter ein anderes Belt and Braces bauen, und du hättest ein Gebäude voller Trolle. Du bist nicht der Erste, der sich an diesem kleinen Gedankenexperiment versucht.«
»Da bin ich sicher«, räumte er ein. »Es tut mir leid, wenn es langweilig ist. Ich begreife die Theorie, aber mir scheint, sie kann einfach nicht funktionieren.«
»Theoretisch funktioniert es überhaupt nicht. In der Theorie sind wir selbstsüchtige Arschlöcher, die mehr als die Nachbarn haben wollen und die nicht glücklich sind, wenn jemand anders viel mehr besitzt. In der Theorie kommt jemand herein, wenn kein anderer da ist, und nimmt alles weg. In der Theorie ist das hier Schwachsinn. Solche Sachen funktionieren nur in der Praxis. In der Theorie ist es das Chaos.«
Er kicherte. Ein unerwartetes, jugendliches Geräusch.
»Ich habe noch ein paar Fragen dazu, aber du hast so schnell reagiert, dass ich wette, du kannst so viele Antworten ausspucken, wie du willst.«
»Oh, ganz bestimmt.« Sie mochte ihn, obwohl er ein Schlepper war. »Ob es skaliert? Bisher ganz gut. Was passiert auf lange Sicht? Ein kluger Mensch sagte mal …«
»Auf lange Sicht sind wir alle tot.«
»Aber wer weiß, nicht wahr?«
»Diesen Mist glaubst du doch nicht, oder?«
»Du nennst es Mist, ich nenne es offensichtlich. Wenn du reich bist, musst du nicht sterben, so viel ist klar. Wenn du dir die ganze Bandbreite der Therapien ansiehst … Keimplasmaoptimierung, ständige Überwachung der Gesundheit, Gentherapie, bevorzugte Behandlung bei Transplantationen … Würde ich an Privateigentum glauben, dann könnte ich dir ausrechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass die erste Generation unsterblicher Menschen schon heute lebt. Sie werden die eigene Sterblichkeit überwinden und überdauern.«
Sie sah, wie er versuchte, ihr zu widersprechen, ohne unhöflich zu wirken, und erinnerte sich, wie große Sorgen sie sich gemacht hatte, jemanden zu verletzen, als sie weggegangen war. Es war hinreißend.
»Nur weil man bis zu einem gewissen Punkt Geld gegen Lebenserwartung eintauschen kann, darf man doch nicht behaupten, dass es beliebig skaliert«, sagte er. »Du kannst Geld gegen Land eintauschen, aber wenn du versuchst, Block für Block New York City zu kaufen, geht dir irgendwann das Geld aus, ganz egal, mit wie viel du begonnen hast, denn wenn das Angebot kleiner wird …« Er schüttelte den Kopf. »Ich meine, wenn es um Gesundheit geht, gibt es so etwas wie Angebot und Nachfrage ja nicht, aber auf jeden Fall bekommst du für den gleichen Aufwand immer weniger Ergebnisse. Zu glauben, dass die Wissenschaft im gleichen Maße fortschreitet wie die eigene Sterblichkeit, ist Unfug.« Er schien verlegen. Sie mochte den Kerl. »Das ist ein Glaubenssatz. Ist nicht persönlich gemeint.«
»Kein Problem. Du hast aber den wichtigsten Punkt übersehen. Lebensverlängerung ist nur möglich auf Kosten der Lebensqualität. Dreihundert Kilometer in diese Richtung«, sie deutete nach Süden, »lebt ein Mann, der mehr Geld hat, als die meisten Länder wert sind. Er besteht nur noch aus Organen und Hirnzellen im Tank. Der Tank befindet sich in einer befestigten Klinik und die Klinik in einer befestigten Stadt. Jeder, der in dieser Stadt arbeitet, ist ein Teilchen in der Mikrobennation dieses Mannes. Das ist eine Bedingung im Arbeitsvertrag. Wir haben hundertmal mehr nicht- menschliche als menschliche Zellen im Körper. Die Menschen, die in dieser Stadt leben, sind zu neunundneunzig Prozent ein unsterblicher reicher Mann, reine Erweiterungen seines Körpers. Sie tun nichts anderes, als daran zu arbeiten, sein Leben zu verlängern. Die meisten haben an den besten Universitäten der Welt in ihren Fächern die besten Abschlüsse gemacht. Sie wurden direkt nach dem Abschluss eingestellt und bekommen Gehälter, die ihresgleichen suchen. Ich bin mal jemandem begegnet, der dort gearbeitet, dann aber alles aufgegeben hat und weggegangen ist. Er sagte, der Mann im Tank leidet unablässig. Irgendetwas hat sein Schmerzempfinden veranlasst, ›ewige, nicht nachlassende Spitzenbelastung‹ zu signalisieren. Er fühlt so viel Schmerz, wie es einem Menschen überhaupt möglich ist. Schmerzen, an die man sich nicht gewöhnen kann. Er könnte den Leuten befehlen, die Maschinen abzustellen, dann wäre er tot. Aber er hält an diesem Zustand fest. Er setzt darauf, dass irgendein Supergenie in seiner Stadt, das auf die Prämien für die Beseitigung der Bugs im persönlichen Bugtracker dieses Mannes scharf ist, früher oder später herausfindet, wie man diese Nervensache in den Griff bekommt. Wenn alles nach Plan läuft, wird es Durchbrüche geben. Deshalb ist der Tank nur das Larvenstadium. Man muss das nicht glauben, aber es ist die Wahrheit.«
»Das ist nicht verrückter als andere Geschichten, die ich über die Zottas gehört habe. Unwahrscheinlich klingt nur, dass dein Freund weggegangen ist. Es scheint sich um einen Vertrag zu handeln, bei dem man gehetzt wird wie ein tollwütiger Hund, weil man die Geheimhaltungsbestimmungen verletzt hat.«
Sie erinnerte sich an den Mann, der sich Langerhans genannt hatte und sehr vorsichtig gewesen war – tote Briefkästen und ungeheuer viel Mühe, um ja keine Hautzellen und Follikel zu hinterlassen. Er hatte immer die benutzten Gläser und das Besteck abgewischt. »Er hat sich fast unsichtbar gemacht. Und was das Geheimhaltungsabkommen angeht, so hatte er verrückte Sachen zu erzählen, aber nichts, was ich hätte benutzen können, um selbst ein solches Programm zu starten oder den Mann im Tank zu sabotieren. Er war raffiniert. Absolut gestört. Aber klug. Ich habe ihm geglaubt.
Es ist so, wie ich es gesagt habe. Der Mann nimmt unvorstellbare Schmerzen hin, weil er an dem Aberglauben festhält, er könne sich vom Tod freikaufen. Die Tatsache, dass dieser Mann das glaubt, hat keinerlei Bezug zur Realität. Vielleicht verbringt dieser Mann noch hundert Jahre in seiner unendlichen Hölle. Zottas sind, was Selbsttäuschungen angeht, genauso gut wie jeder andere. Sogar noch besser. Sie sind überzeugt, sie hätten das erreicht, was sie sind, weil sie die evolutionäre Speerspitze darstellen, die es verdient hat, sich über das Fußvolk zu erheben. Sie sind überzeugt, dass alles, was sie fühlen, der Wahrheit entspricht. Was, abgesehen von dem blinden, eigennützigen Glauben dieses Zottareichen selbst, bringt dich auf die Idee, es sei irgendetwas anderes als Wunschdenken?«
Limpopo erinnerte sich an Langerhans’ Gewissheit, an seine leisen, eindringlichen Vorträge über das kommende Zeitalter der unsterblichen Zottareichen, deren Familiendynastien von ewigen Tyrannen angeführt würden.
»Ich muss zugeben, dass ich nichts in der Hand habe, um es zu beweisen. Alles, was ich weiß, habe ich aus zweiter Hand von jemandem erfahren, der schreckliche Angst hatte. Dies ist eine der Situationen, in denen es sich lohnt, so zu tun, als wäre alles wahr, auch wenn es niemals so weit kommt. Die Zottas versuchen, sich von der übrigen Menschheit abzusetzen. Sie meinen, ihr Schicksal sei nicht mit unserem verknüpft. Sie glauben, sie könnten sich politisch, wirtschaftlich und epidemiologisch isolieren, sich über den steigenden Meeresspiegel erheben und ihre Nachkommen in Senkrechtstartern großziehen.
Ich war schon fast ein Jahr im Walkaway, als mir dies bewusstwurde. Das ist es nämlich, was das Weggehen wirklich ausmacht. Es geht nicht darum, die ›Gesellschaft‹ zu verlassen, sondern anzuerkennen, dass wir in der Zotta-Welt Probleme darstellen, die es zu lösen gilt, aber keine Bürger. Deshalb reden auch die Politiker nie über Bürger, sondern immer nur über Steuerzahler, als wäre die Summe der Steuern, die du zahlst, der entscheidende Faktor in deiner Beziehung zum Staat. Als wäre der Staat eine Firma und die Staatsangehörigkeit ein Treueprogramm, das dich für deine Beiträge mit Straßen und Gesundheitsfürsorge belohnt. Die Zottas haben den Prozess manipuliert, damit sie das gesamte Geld einheimsen und den politischen Prozess steuern können, wobei sie so viel oder so wenig Steuern bezahlen, wie sie wollen. Gewiss, sie entrichten den größten Teil der Steuern, weil sie die Regeln so gestaltet haben, dass sie auch am meisten Geld verdienen. Aber wenn man über ›Steuerzahler‹ spricht, bedeutet dies, dass der Staat bei den reichen Leuten verschuldet ist, und alles, was er Kindern, alten Menschen, Kranken oder Behinderten gibt, ist ein Almosen, für das wir dankbar sein sollen, denn keiner dieser Menschen bezahlt genügend Steuern, um die Belohnungen von der Regierungs-GmbH auszugleichen.
Ich lebe, als ob die Zottas nicht glauben würden, dass sie der gleichen Spezies angehören wie ich, was die Unausweichlichkeit von Tod und Steuern einschließt, weil sie dies glauben. Willst du wissen, wie gut sich das Belt and Braces selbst trägt? Die Antwort darauf ist an unser Verhältnis zu den Zottas gebunden. Wenn sie wollen, könnten sie uns morgen zerschmettern, aber das tun sie nicht, denn wenn sie ihre Situation nüchtern betrachten, ist ihnen besser damit gedient, dass einige von uns Problemfällen sich selbst ›lösen‹, indem sie sich aus dem politischen Prozess zurückziehen, besonders da wir die Menschen sind, die im Großen und Ganzen den meisten Ärger machen würden, wenn sie blieben …«
»Komm schon.« Er hatte ein schönes Lächeln. »Da du gerade von Eigennutz sprichst … Wie kommst du auf die Idee, wir machten den größten Ärger? Vielleicht wird man mit uns besonders leicht fertig, weil wir doch bereit sind, wegzugehen. Was ist mit den Leuten, die zu krank, zu jung, zu alt oder zu störrisch sind und verlangen, der Staat müsse sich damit abfinden, dass sie als Bürger innerhalb des Systems existieren?«
»Diese Leute können besonders leicht zusammengetrieben und in Anstalten gesperrt werden. Deshalb können sie auch nicht weglaufen. Es ist monströs, aber wir reden über monströse Dinge.«
»Das ist unheimlich«, gestand er. »Und plakativ. Glaubst du wirklich, die Zottas sitzen in der Sternkammer und überlegen sich, wie man die Ziegen von den Schafen trennt?«
»Natürlich nicht. Verdammt, wenn sie das täten, dann könnten wir die Ärsche als Selbstmordattentäter in die Luft jagen. Ich glaube aber, es läuft genau darauf hinaus. Das ist sogar noch übler, weil es in einer Zone unklarer Verantwortlichkeiten stattfindet. Niemand beschließt, eine Rekordzahl von Armen einzusperren. Es passiert einfach infolge schärferer Gesetze, geringerer Mittel für juristische Hilfe und zusätzlicher Kosten für Berufungsverfahren … es gibt keine Person, keine Entscheidung und keinen politischen Prozess, denen man die Schuld geben könnte. Es ist systemisch bedingt.«
»Was ist die systemische Folge, wenn man ein Walkaway wird?«
»Ich glaube, das weiß noch niemand. Es wird aber sicher spannend, es herauszufinden.«
Cory Doctorow: „Walkaway“ ∙ Roman ∙ Aus dem Englischen von Jürgen Langowski ∙ Wilhelm Heyne Verlag, München 2018 ∙ 736 Seiten ∙ Preis des E-Books € 13,99 (im Shop)



Kommentare