„Ich bin jemand, der Tradition schätzt.“
Im Gespräch mit Christopher Ruocchio, Autor von „Das Imperium der Stille“
„Das Imperium der Stille“, der erste Band der „Sonnenfresser-Saga“, ist das epische Science-Fiction-Romandebüt des Amerikaners Christopher Ruocchio (im Shop). In seinem fast 1.000 Seiten starken Zukunftsroman „Das Imperium der Stille“ zeigt Ruocchio ein von der Menschheit besiedeltes Universum lange nach Aufgabe der Alten Erde, in dem der Einsatz von Technologie streng überwacht wird, es allerhand Alien-Arten gibt und mit dem Schwert im gleichen Maße gekämpft wird wie mit Energiewaffen oder mit politischer Intrige. In diesem riesigen, traditionsreichen Genre-Kosmos zeichnet Ruocchio den Weg seines Protagonisten Hadrian Marlowe nach, des größten Helden und zugleich Schlächters der Galaxie, der eine ganze Sonne ermordete. Hadrian selbst erzählt dem Leser in der Rückschau auf sein bewegtes Leben, wie aus einem adeligen Sohn ein Gestrandeter, ein Ausgestoßener, ein Gladiator und eine Legende wird. Ruocchio besuchte die North Carolina State University und arbeitet als Assistent Editor beim US-Verlag Baen Books. Sein Einstand als SF-Romancier begeisterte erfolgreiche Kollegen wie James Corey (im Shop) oder Kevin J. Anderson (im Shop) und wird ebenso oft mit Frank Herberts „Dune“-Auftakt „Der Wüstenplanet“ (im Shop) wie mit Patrick Rothfuss’ „Der Name des Windes“ verglichen. Im Interview spricht Christopher Ruocchio über Genre-Traditionen, seine Arbeitsweise, das Standing der Space Fantasy und den Druck angesichts langer Wartezeiten bei anderen epischen Serien.

Hallo Herr Ruocchio. Man spürt in Ihrem Debütroman viele Einflüsse – welchen würden sie als den größten und wichtigsten bezeichnen?
Mein größter Einfluss ist sicherlich Frank Herbert. Ich entdeckte „Der Wüstenplanet“ für mich, als ich ungefähr elf oder zwölf Jahre alt war, und es hinterließ einen bleibenden Eindruck bei mir. Davor war es „Star Wars“ (im Shop), das mich wirklich zu einem Science-Fiction-Fan machte. Also das originale „Star Wars“, einschließlich der ersten paar Runden an Romanen und selbst, in geringerem Maße, der Prequel-Filme – ich war sehr jung, als diese herauskamen, weshalb ihre Schwächen für mich weniger offensichtlich waren. J. R. R. Tolkien war ebenfalls äußerst wichtig für meine Entwicklung, sowohl als Autor wie auch als Mensch. Science-Fiction und Fantasy hatten nie einen feineren Autor als Professor Tolkien, und die ethische und essenziell moralische Natur seiner Geschichten blieb ein Teil von mir, als ich älter wurde. Um an dieser Stelle auch etwas überraschendes zu sagen: Außerdem wurde ich schwer von japanischen Videogames beeinflusst, namentlich RPGs wie Tales of Symphonia, Baten Kaitos und Lost Odyssey. Die Japaner haben meist eine andere Haltung hinsichtlich Genres und Tropen als wir Westländer, und ich finde diesen Unterschied der Vision faszinierend und wertvoll.
Herbert und Tolkien verkörpern die fantastischen Traditionen. Gehört das im eigenen Buch kommunizierte Genre-Traditionsbewusstsein heute mehr denn je dazu, als Subtext und Programmiersprache für Fans, damit diese wissen, dass Sie aus ihrer Mitte stammen und für sie schreiben?
Ich weiß nicht, ob es für jeden Autor dazugehört, aber für mich auf jeden Fall. Ich glaube, dass es grundsätzlich zwei Arten von Autoren gibt: Da sind die Autoren, die Genre-Traditionen als Kunstform ehren und innerhalb dieser Traditionen etwas Schönes erschaffen wollen; und da sind jene Autoren, die das nicht wollen und diese Traditionen und Erwartungen lieber umstürzen. Ich mag die zweite Sorte Autoren nicht besonders. Wie Tolkien, bin ich jemand, der Tradition und traditionelles Geschichtenerzählen wertschätzt – auch wenn ich eine Geschichte auf meine Art erzählen will. „Das Imperium der Stille“ enthält recht offensichtliche Verweise und Referenzen auf Autoren wie Frank Herbert und Iain M. Banks (im Shop), genauso wie auf „Star Wars“ und „Doctor Who“ (manche davon offensichtlicher als andere). Das ist teilweise nostalgisch gemeint, doch im Buch sind jede Menge Easter Eggs und Referenzen versteckt – und noch einige substanziellere Dinge, wie der Hass meines Imperiums auf künstliche Intelligenz –, von denen ich hoffe, dass sie meinen Lesern signalisieren, dass ich genauso ein Fan bin wie sie. Vielleicht ist das eine seltsame Sache in einem ansonsten sehr ernsten Roman, aber ich hoffe wirklich, dass meine Leser am Ende meinen Respekt für die Autoren spüren, die vor mir kamen.
 Kann Traditionsbewusstsein der Originalität im Weg stehen, und muss man da als Autor dann besonders aufpassen?
Kann Traditionsbewusstsein der Originalität im Weg stehen, und muss man da als Autor dann besonders aufpassen?
Betrachten wir es einmal von dieser Seite: Wie viele Kirchen gibt es in Europa? Abertausende. Sie alle haben ähnliche Designs, alle dienen sie demselben Zweck, und sie alle erzählen dieselbe Geschichte Doch jede Kirche in Europa ist einzigartig und auf ihre Weise wunderschön. Irgendwer sagte einmal, dass es nur zwei Arten von Geschichten gibt: ein Mann geht auf eine Reise, oder ein Fremder kommt in eine Stadt. Ich weiß nicht, ob es so einfach ist, doch meiner Meinung nach sollten sich Autoren mehr darauf konzentrieren, ihre Geschichte gut zu erzählen, anstatt sich über Originalität Gedanken zu machen. Was ja nicht heißt, dass es dann keine Überraschungen gibt. Trotz all der Vergleiche zwischen meinem Roman und „Der Wüstenplanet“, ist „Das Imperium der Stille“ ein ganz anderes Buch. Herbert hatte zunächst einmal keine Aliens; dafür versuchte er zu zeigen, dass Helden verheerend für die Menschen sind, die zu retten sie kommen – ich glaube an Helden, selbst wenn sie schreckliche Dinge tun. Für mich ist und muss Tradition ein Punkt zum Starten sein, doch bauen wir auf dieser Tradition immer neue Dinge auf. Leute haben festgehalten, dass sich mein Roman stark nach „Der Wüstenplanet“ anfühlt, doch das gilt ehrlich gesagt nur für den Anfang. Ich wollte meine Leser in eine vertraute Umgebung versetzen, damit sie wissen, dass sie eine Geschichte vor sich haben, die sie mögen werden, weil das Ganze sie an ein klassisches Science-Fiction-Abenteuer erinnert – und dann ganz woanders hinbringen. Zu viele Autoren denken, dass es das Beste ist, Tradition zu zerstören, sie einzureißen und von vorne zu beginnen. Ich bin kein Postmodernist, ich sehe das anders. Ich hoffe, dass meine Leser meine Begeisterung für großartige Science-Fiction der Vergangenheit teilen, während wir das Genre in die Zukunft bringen.
Ist die Space Fantasy, abgesehen von „Star Wars“, in den letzten Jahren in Ungnade gefallen zwischen Dystopie, Cyberpunk und Military-SF?
In Ungnade gefallen? Nein! Doch ich glaube, dass sie in den letzten Jahren etwas weniger populär war. Ich hatte angenommen, dass das Revival von „Star Wars“ daran etwas ändern könnte. Mir haben die neuen „Star Wars“-Filme nicht allzu sehr gefallen, trotz meiner Liebe für das Franchise. Ich bin mir nicht im Klaren darüber, ob der Fallout und die Kontroverse, die „Die letzten Jedi“ umgaben, den Enthusiasmus für das Genre abgetötet haben oder ob sich neuen Autoren wie mir dadurch eine großartige Gelegenheit bietet. Ich hoffe, etwas erschaffen zu haben, das Space Fantasy-Fans jeder Geschmacksrichtung und Umschreibung mögen werden. Es ein fabelhaftes Genre, aber tricky. In Animes und Videogames gibt es viel Space Fantasy, doch nicht viele Bücher sind bei einem breiten Publikum erfolgreich. Ich wollte ein Buch schreiben, das Fans von epischer Fantasy und von Autoren wie Tolkien, George R. R. Martin (im Shop) und Brandon Sanderson (im Shop) gefällt, das aber auch eine Far-Future-Ästhetik und eine Sensibilität gegenüber unserer Wirklichkeit besitzt.
 Ab wann wussten Sie, dass Ihr Roman einen Ich-Erzähler haben würde?
Ab wann wussten Sie, dass Ihr Roman einen Ich-Erzähler haben würde?
Ich weiß nicht mehr genau, wann ich umstellte. Man muss sich vor Augen führen, dass ich seit meinem achten Lebensjahr an Versionen dieser Geschichte schreibe und sie so viele Neufassungen und Verwandlungen durchlief, dass ich mich nur schwer erinnern kann, wann neue Elemente in den Mix dazu kamen. Mein Roman wurde mit Patrick Rothfuss’ „Der Name des Windes“ oder Piers Anthonys „Der Tyrann von Jupiter“ (das ich nie gelesen habe) verglichen, doch die Wahrheit ist, dass ich diese Geschichte schon schrieb, bevor ich überhaupt nur wusste, wer Mr. Rothfuss oder Mr. Anthony sind. Ein Ich-Erzähler ist interessant. Jedes Wort im Buch dient dazu, die Persönlichkeit meines Hauptcharakters zu entwickeln, selbst wenn ich die Farbe einer Mauer beschreibe, und alles wird durch seine Wahrnehmungen gefiltert. Er könnte sogar über Dinge lügen. Gleichzeitig bedeutet es, dass ich meinem Leser keine Information geben kann, die mein Held nicht besitzt. Ich kann nicht in den Kopf von jemand anderem oder zu einer anderen Location springen. Das ist es meines Erachtens nach aber wert, da ich einen tiefen Blick in den Geist meines Charakters werfen kann.
Arbeiten Sie mit einem strikten Exposé und täglichen Schreibzielen, oder eher frei und explosiv?
Ich versuche, 2.000 Wörter am Tag zu schreiben, jeden Tag, und ich lasse mich nie weniger als 500 Wörter schreiben. Ich betrachte einen Tag als vergeudet, wenn ich ein Projekt, an dem ich zur Zeit arbeite, nicht vorangebracht habe. Da ich selbst bei einem Verlag arbeite, habe ich entdeckt, dass viele Autoren – da sie nun mal Künstler sind – dazu neigen, chronisch spät dran zu sein, und sich nach ihrem Flow richten. So bin ich nicht. Ich plane mein Schreiben rigoros (die Outline für „Das Imperium der Stille“ war rund 50 Seiten lang) und führe täglich Buch über meine Fortschritte – und ich mache mein Vorankommen auf Twitter für meine Leser öffentlich, damit sie mir ehrlich glauben können. Schreiben ist eine Kunst, aber auch ein Handel. Ich sehe mich gern als einen Tusche-und-Papier-Kaufmann, und als solcher werde ich nicht bezahlt, wenn ich meine Arbeit nicht mache.
Haben Sie aus Ihrer täglichen Arbeit als Editor für Baen Books noch etwas für Ihre eigenen Romane mitgenommen?
Der offensichtliche Vorteil meines Doppellebens ist die Gelegenheit, alle Arten von tollen Autoren zu treffen. Ich habe mich mit Leuten wie Lois McMaster, David Weber (im Shop) und Brian Lee Durfee angefreundet, und ich habe die Möglichkeit, durch ganz Amerika zu reisen, wunderbare Conventions zu Besuchen und Leser aus New York oder Kalifornien zu treffen. Gerade erst bin ich von einer Show in Mississippi zurückgekommen, wo ich das Vergnügen hatte, L. E. Modesitt zu treffen, und diese Chance hätte ich nicht so früh in meiner Karriere bekommen, wenn ich nicht für Baen Books arbeiten würde. Darüber hinaus kann man mit mir als Autor aufgrund meines Jobs als Editor noch besser zusammenarbeiten als vorher. Als Editor habe ich gelernt, womit Autoren die Redakteure und Lektoren am meisten verärgern, und kann solches Verhalten vermeiden – und umgekehrt. Mein Respekt für Pünktlichkeit – nie eine meiner Schwachstellen – wurde noch größer, genauso wie meine Achtung für klare, prompte E-Mail-Antworten. Sie würden mir nicht glauben, wie viele Autoren ihre E-Mails nicht checken!
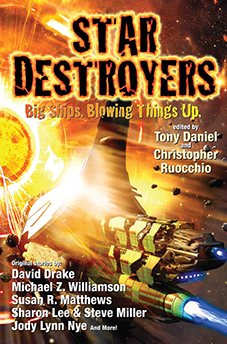
Wie sieht Ihr Arbeitstag in der Regel aus?
Ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf und schreibe zwei Stunden, bevor ich ins Büro gehe, meinen Job erledige, heimkomme, zu Abend esse und dann solange weiterschreibe, bis ich mein Tagespensum geschafft habe, wonach ich – abhängig vom Tag – entweder zum Boxtraining gehe, mich um die notwendigen Dinge des Lebens kümmere oder meine Freundin anrufe, die im weit entfernten Miami lebt. Ich denke, es ist wichtig, auch Erholungszeit einzuplanen, was etwas ist, das ich von Cicero gelernt habe, der seine Hobbys genauso fest plante wie seine harte Arbeit als römischer Senator.
Ihre Urgroßeltern kamen aus Deutschland. Was für eine Connection haben Sie zu Deutschland, und bemerken Sie an sich als Autor womöglich sogar noch mehr „deutsche Tugenden“ als die Pünktlichkeit?
Mein Urgroßvater kam aus Würzburg, seine Frau aus Stuttgart. Sie trafen sich in den 1930ern in New York City, und ihre Tochter heiratete meinen Großvater (daher der italienische Nachname). Ich habe mitbekommen, dass es für Europäer manchmal befremdlich ist, dass wir Amerikaner so viel Wert auf unsere Herkunft und unser Erbe legen, aber ich liebe seit jeher Geschichte, speziell Familiengeschichte. Ich bin schon immer eine sehr disziplinierte Person gewesen, daher auch der eben erwähnte Schreibplan, aber ob das mein deutsches Erbe ist oder ein römisches Überbleibsel, kann ich nicht sagen (Selbstdisziplin ist nicht gerade eine italienische Tugend, man schaue sich nur den Verkehr in Italien an!). Abseits der Klischees fühlte ich mich der Bewegung der deutschen Romantik immer sehr verbunden, sei es in der Musik, in der Literatur oder in Gemälden. Mir gefällt der Gedanke, dass man ein gewisses Aroma davon in meinen Geschichten finden kann.
Was machte Ihnen beim Schreiben von „Das Imperium der Stille“ die meiste Freude?
Am liebsten schreibe ich Dialoge, ohne Ausnahme. Gewitzte Unterhaltungen, die hin und her gehen, sind ein gewaltiges Vergnügen. Ich bin eine ausgesprochen auditive Person und neige dazu, mir mein Geschriebenes während des Schreibens laut vorzulesen, und so richtig in den Figuren zu versinken, ist ein absoluter Genuss. Daneben mag ich gute Actionszenen, speziell wie gegen Ende des ersten Romans, wenn die Cielcin-Aliens die Bühne betreten. Auf einige dieser Szenen bin ich besonders stolz. Auch die etwas gruseligeren Passagen der Bücher bereiten mir Freude. Die Cielcin können manchmal recht unheimlich sein. Diese Szenen haben ein wenig von Edgar Allan Poe und H. P. Lovecraft, was jetzt, während ich die folgenden Bände schreibe, noch mehr Spaß macht. Ich hatte es nicht darauf abgesehen, ein Horror-Autor zu werden, doch ich denke, dass die Bücher selbst Horror-Fans etwas geben, das sie genießen können.
Ihr Roman ist mit knapp 1000 Seiten nicht gerade dünn. Muss man dem Publikum, um gegen das zeitverschlingende Bingen von TV-Serien bestehen zu können, als Buchautor richtig was zum Kauen geben?
Ich habe es nie in Verbindung zum Phänomen des Binge-Watchings gesetzt, aber damit mögen Sie recht haben. Ich persönlich habe schon immer lange Romane geschätzt. Ich mag es, mir die Zeit zu nehmen, in eine Welt einzutauchen und mit einer Gruppe Charaktere zu leben – längere Bücher haben den Raum, ein Universum mit subtilen Details und Momenten lebendig werden zu lassen, für die kürzeren Büchern schlicht und ergreifend die Zeit fehlt. „Das Imperium der Stille“ ist vor allem eine Biografie. Hadrian den Raum dafür zu geben, seine Meinung zu sagen und seine Gedanken mitzuteilen, ist ausschlaggebend für seinen Charakter und dafür, die Geschichte als Ganzes zu erfahren, und das hätte ich nicht mit weniger Umfang gekonnt (obwohl ich vermute, dass wir „Das Imperium der Stille“ in zwei oder drei schmalere Bücher hätten aufteilen können, wenn wir das wirklich gewollt hätten!).
Ob George R. R. Martin oder Patrick Rothfuss: Manche epischen Serien kommen unterwegs ins Schleudern, was die Erscheinungsweise angeht. Machen sie sich Sorgen, was Ihr eigenes Epos angeht, und entsteht durch die „großen Negativbeispiele“ zusätzlich Druck?
Ich für meinen Teil verspüre deshalb keinen Druck. Ich habe meinen zweiten Roman, der im Original „Howling Dark“ heißt, bereits bei meinem amerikanischen Lektor eingereicht – genau genommen schon drei Monate, bevor „Das Imperium der Stille“ auf Englisch als „Empire of Silence“ in die Buchläden kam. Mein Plan sieht vor, Buch drei fertig zu haben, bevor Band zwei veröffentlicht wird, und so weiter. Gerade eben habe ich sogar erst einen Kurzroman beendet, in dem es um Hadrians jüngeren Bruder Crispin geht, den ich veröffentlichen möchte, sobald ich ihn fertig überarbeitet habe. Ich empfinde nichts als Sympathie für Mr. Martin und Mr. Rothfuss – ich beneide sie nicht um den Druck, den sie fühlen müssen, während sie sicherstellen, dass ihre nächsten Bücher den Erwartungen ihrer Leser gerecht werden. Davon abgesehen habe ich mehrere Autorenfreunde, die Selfpublisher sind. Sie müssen alle vier bis sechs Monate neuen Content produzieren, sonst verlieren sie ihre Relevanz und ihr Publikum. Sie müssen wettbewerbsfähig sein. Ich hoffe, dass ich Autoren wie Brandon Sanderson oder Larry Correia nacheifern kann und Geschichten in einer Frequenz veröffentliche, die dafür sorgt, dass meine Leser mir gewogen bleiben. Allerdings wünschte ich mir, dass Leser in Hinblick auf Mr. Martin und Mr. Rothfuss tief durchatmen würden. Ich hatte erst seit dreieinhalb Monaten ein Buch auf dem Markt, als ich verschiedene Leser traf, die ganz schön energisch darauf beharrten, durch „Der Name des Windes“ so verbrannt worden zu sein, dass sie keine neue Serie anfangen wollen, bevor diese nicht abgeschlossen ist. Ich kann das verstehen, aber wenn niemand mein Buch kaufen würde, ehe die Serie zu Ende ist, hätte ich keine Karriere.
Gibt es noch etwas, das Sie Ihren deutschen Lesern sagen wollen?
Ich hoffe, Ihnen allen gefällt „Das Imperium der Stille“. Es ist ein Liebesdienst für ein Genre und ein Liebesbrief an eine Kunstform, die mir sehr viel bedeuten. Vielen Dank fürs Lesen!
Christopher Ruocchio: Das Imperium der Stille • Originaltitel: Empire of Silence (Sun Eater Cycle) • Aus dem Amerikanischen von Kirsten Borchardt • 992 Seiten • Wilhelm Heyne Verlag • E-Book: 13,99 € (im Shop)



Kommentare