Cogito ergo sum!
„Boy in a White Room“ sucht nach der menschlichen Identität im digitalen Zeitalter
Wenn ein Buch binnen kürzester Zeit in seine dritte Auflage geht, hat der Verlag einen wahren Glücksgriff getan und der Autor den Nerv der Zeit getroffen. Dieses Kunststück ist Karl Olsberg mit seinem Jugendroman „Boy in a White Room“ gelungen, einem der interessantesten Technothriller der letzten Jahre. In ihm wird der Dämon aus Réne Descartes Erkenntnistheorie mit den neuesten technologischen Entwicklungen verknüpft. Das Ergebnis? Nichts ist so, wie es scheint…
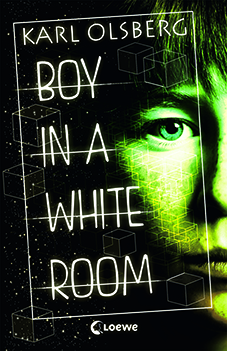 Der 15-jährige Manuel erwacht eines Tages in einem quadratischen weißen Raum. Weder erinnert er sich daran, wer er ist, noch hat er eine Idee, wie er in das Zimmer gelangen konnte. Zudem sind seine Sinne eingeschränkt. Zwar kann er sehen und hören und die Wände auch berühren, er hat jedoch keinerlei Gefühl in seinen Händen oder seiner Stimme, die sich computergeneriert anhört. Seine einzige Kommunikationspartnerin ist zunächst das Computerprogramm „Alice“, das ihn als „Patienten“ bezeichnet. Nachdem Manuel herausgefunden hat, dass die Wände als Touchscreens fungieren mit deren Hilfe er ins Internet gelangen kann, erscheint sein Vater im Raum. Er offenbart seinem Sohn, dass er einer gescheiterten Entführung zum Opfer fiel, bei der seine Mutter ums Leben kam und er so schwer verletzt wurde, dass er seinen Körper nie wieder benutzen könne. Um seinem Sohn eine „Existenz“ zu ermöglichen, habe der erfolgreiche IT-Geschäftsmann und Multimillionär keinerlei Kosten und Mühen gescheut, und eine virtuelle Realität erschaffen, in der sein Sohn weiter leben kann, während dessen Gehirn durch Implantate mit dem digitalen Raum verbunden ist. Doch obwohl sein Vater alles erdenkliche tut und sogar eine Kopie von Mittelerde erstellen lässt, kommen Manuel erste Zweifel an der Geschichte. Als er bei seinen digitalen Streifzügen durch Hamburg auf seine (angeblich nicht existierende) Schwester Julia und den Ex-Geschäftspartner seines Vaters trifft, ahnt er, dass mit ihm ein falsches Spiel gespielt wird. Manuel beschließt aus dem Raum auszubrechen…
Der 15-jährige Manuel erwacht eines Tages in einem quadratischen weißen Raum. Weder erinnert er sich daran, wer er ist, noch hat er eine Idee, wie er in das Zimmer gelangen konnte. Zudem sind seine Sinne eingeschränkt. Zwar kann er sehen und hören und die Wände auch berühren, er hat jedoch keinerlei Gefühl in seinen Händen oder seiner Stimme, die sich computergeneriert anhört. Seine einzige Kommunikationspartnerin ist zunächst das Computerprogramm „Alice“, das ihn als „Patienten“ bezeichnet. Nachdem Manuel herausgefunden hat, dass die Wände als Touchscreens fungieren mit deren Hilfe er ins Internet gelangen kann, erscheint sein Vater im Raum. Er offenbart seinem Sohn, dass er einer gescheiterten Entführung zum Opfer fiel, bei der seine Mutter ums Leben kam und er so schwer verletzt wurde, dass er seinen Körper nie wieder benutzen könne. Um seinem Sohn eine „Existenz“ zu ermöglichen, habe der erfolgreiche IT-Geschäftsmann und Multimillionär keinerlei Kosten und Mühen gescheut, und eine virtuelle Realität erschaffen, in der sein Sohn weiter leben kann, während dessen Gehirn durch Implantate mit dem digitalen Raum verbunden ist. Doch obwohl sein Vater alles erdenkliche tut und sogar eine Kopie von Mittelerde erstellen lässt, kommen Manuel erste Zweifel an der Geschichte. Als er bei seinen digitalen Streifzügen durch Hamburg auf seine (angeblich nicht existierende) Schwester Julia und den Ex-Geschäftspartner seines Vaters trifft, ahnt er, dass mit ihm ein falsches Spiel gespielt wird. Manuel beschließt aus dem Raum auszubrechen…
Seit seinem Romandebüt 2007 („Das System“, Aufbau Verlag) beschäftigt sich der studierte Betriebswissenschaftler und Start-Up-Gründer (Papego) mit dem Einfluss moderner Technologien auf den Menschen. Wer wie er über Künstliche Intelligenz promoviert hat, kennt sich mit deren Chancen und Risiken aus. Zuletzt hat er sich 2016 in „Mirror“ (Aufbau Verlag) mit digitalen Avataren und ihre Wirkung auf reale Personen befasst. In „Boy in a White Room“ analysiert Olsberg jugendgerecht philosophische Probleme im digitalen Zeitalter. Dabei spannt er einen großen Bogen von der Medizinethik über die Gefahren perfekter Imitationen der realen Welt im virtuellen Raum, bis hin zu den Risiken von KI. So entwickelt sich aus dem anfänglichen Technikthriller ein philosophisches Lehrstück über Menschlichkeit und Wahrheit. Am Ende steht die Frage, was den Menschen als Menschen ausmacht. Descartes fasste dies im 17. Jahrhundert mit „Cogito ergo sum“ zusammen, „Ich denke, also bin ich.“ Bis Manuel zu der Erkenntnis gelangt, wer bzw. was er ist, werden er und die Leser über seine Identität im Dunkeln gelassen. Und selbst der überraschende Schluss lässt offen, ob der jugendliche Held nicht bloß einen weiteren Test bestehen muss, um den Schein vom Sein trennen zu können.
Obwohl „Boy in a White Room“ als Jugendbuch konzipiert wurde, zieht der Roman auch Erwachsene in seinen Bann. Karl Orlsberg entwickelt aus dem wohl abgedroschensten Ausgangsszenario der Phantastik einen eindringlichen und lesenswerten philosophischen Exkurs über Realität, Wahrheit und Identität – eine Geschichte, die nach dem Lesen noch lange nachhalt.
Karl Olsberg: Boy in a White Room • Loewe, Bindlach, 2017 • 288 Seiten • 14,95 € • Empfohlen ab 14 Jahren



Kommentare