Vorhang auf für Takeshi Kovacs
Eine Leseprobe von Richard Morgans Kultroman „Altered Carbon – Das Unsterblichkeitsprogramm“
Haben Sie die letzte Woche jede freie Minute vor dem Fernseher verbracht, um „Altered Carbon – Das Unsterblichkeitsprogramm“ auf Netflix zu verfolgen? Sind Sie inzwischen mit allen Folgen durch und können kaum erwarten, wie es weitergeht? Wie wäre es, sich die Zeit des Wartens einfach mit Richard Morgans Roman, auf dem die Serie basiert, zu vertreiben. Elisabeth Bösl hat bereits drei gute Gründe geliefert, warum „Altered Carbon“ (im Shop) der Hammer ist. Und wer noch einen vierten Grund braucht, für den gibt es hier eine Leseprobe. Viel Vergnügen beim Schmökern.
1
Von den Toten zurückzukehren kann hart sein.
Beim Envoy Corps lernt man, dass man loslassen muss, bevor man eingelagert wird. Auf neutral schalten und sich treiben lassen. Das war die erste Lektion, die die Ausbilder einem von Tag eins an eintrichterten. Virginia Vidaura mit den harten Augen und dem Körper einer Tänzerin im formlosen Overall des Corps, wie sie im Einweisungsraum vor uns auf und ab ging. Macht euch wegen nichts Sorgen, sagte sie, dann werdet ihr auf alles vorbereitet sein. Ein Jahrzehnt später traf ich sie wieder, in einem Arrestbunker der Vollzugsanstalt New Kanagawa. Sie sollte für ein Jahrhundert auf achtzig gehen, wegen exzessiven bewaffneten Raubüberfalls mit organischen Defekten. Das Letzte, was sie zu mir sagte, als man sie aus der Zelle holte, war: »Mach dir keine Sorgen, Junge, sie speichern alles.« Dann beugte sie den Kopf, um sich eine Zigarette anzuzünden, sog den Rauch in Lungen, die ihr nun scheißegal geworden waren, und marschierte den Korridor entlang, als wäre sie zu einer langweiligen Besprechung unterwegs. Im schmalen Sichtfeld, das die Zellentür mir gestattete, beobachtete ich ihre stolze Haltung und sprach flüsternd ihre Worte wie ein Mantra nach.
Mach dir keine Sorgen, Junge, sie speichern alles. Ein wunderbar doppelsinniges Beispiel elementarer Weisheiten. Das trostlose Vertrauen in die Effizienz des Strafvollzugsystems und eine Anspielung auf den flüchtigen Geisteszustand, den man benötigt, um die Klippen der Psychose zu umschiffen. Ganz gleich, was du fühlst, was du denkst, was du bist, wenn du eingelagert wirst – genauso wirst du sein, wenn du wieder herauskommst. Bei Angstzuständen kann das zu einem Problem werden. Also lässt man los. Schaltet auf neutral. Entspannt sich und lässt sich treiben.
Wenn man die Zeit dazu findet.
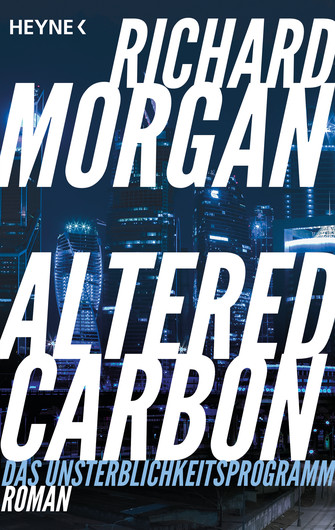 Ich tauchte wild um mich schlagend aus dem Tank auf. Eine Hand klebte auf meiner Brust und suchte nach Verletzungen, die andere klammerte sich um eine nicht vorhandene Waffe. Die Schwerkraft war wie ein Hammerschlag und ließ mich platschend ins Schwimmgel zurückfallen. Ich schlug mit den Armen um mich, stieß mit einem Ellbogen gegen die Tankwand und keuchte vor Schmerz auf. Gelklumpen drangen mir in den Mund und in die Kehle. Ich schloss den Mund und bekam den Rand des Tanks zu fassen, aber das Zeug war einfach überall. Es brannte mir in den Augen, in der Nase und glitt mir schlüpfrig durch die Finger. Die Schwerkraft löste meinen Griff und drückte wie ein Hoch-G-Manöver auf meine Brust, sodass ich wieder im Gel versank. Mein Körper kämpfte verzweifelt gegen die Enge des Tanks. Schwimmgel? Ich ertrank!
Ich tauchte wild um mich schlagend aus dem Tank auf. Eine Hand klebte auf meiner Brust und suchte nach Verletzungen, die andere klammerte sich um eine nicht vorhandene Waffe. Die Schwerkraft war wie ein Hammerschlag und ließ mich platschend ins Schwimmgel zurückfallen. Ich schlug mit den Armen um mich, stieß mit einem Ellbogen gegen die Tankwand und keuchte vor Schmerz auf. Gelklumpen drangen mir in den Mund und in die Kehle. Ich schloss den Mund und bekam den Rand des Tanks zu fassen, aber das Zeug war einfach überall. Es brannte mir in den Augen, in der Nase und glitt mir schlüpfrig durch die Finger. Die Schwerkraft löste meinen Griff und drückte wie ein Hoch-G-Manöver auf meine Brust, sodass ich wieder im Gel versank. Mein Körper kämpfte verzweifelt gegen die Enge des Tanks. Schwimmgel? Ich ertrank!
Unvermittelt wurde mein Arm mit starkem Griff gepackt, und jemand zog mich in eine aufrechte Position. Ich hustete. Erst zu diesem Zeitpunkt stellte ich fest, dass meine Brust unverletzt war, dann wischte mir jemand mit einem Tuch das Gesicht ab, sodass ich wieder sehen konnte. Ich beschloss, mir dieses Vergnügen für später aufzuheben, und konzentrierte mich darauf, den Inhalt des Tanks aus Nase und Kehle zu befördern. Etwa eine halbe Minute lang blieb ich mit gesenktem Kopf sitzen, hustete das Gel aus und versuchte das Rätsel zu lösen, warum sich alles so extrem schwer anfühlte.
»So viel zum Sinn des Trainings.« Es war eine raue männliche Stimme, genau das, was man vom Personal einer Strafvollzugsanstalt erwarten würde. »Was hat man Ihnen bei den Envoys beigebracht, Kovacs?«
In diesem Moment wurde mir alles klar. Auf Harlans Welt war Kovacs ein durchaus geläufiger Name. Jeder wusste, wie man ihn aussprach. Dieser Kerl wusste es nicht. Er benutzte eine gedehntere Variante des Amenglischen, als sie auf Harlans Welt in Gebrauch war, trotzdem klang der Name entstellt, zumal der Schlusslaut ein hartes »ks« statt des slawischen »tsch« war.
Und alles war viel zu schwer.
Die Erkenntnis drang durch meine benebelte Wahrnehmung wie ein Ziegelstein, der durch eine reifbedeckte Fensterscheibe schlug.
Irgendwann im Verlauf der Geschichte hatte man Takeshi Kovacs (d. I.) auf einen anderen Planeten transferiert. Und da Harlans Welt die einzige bewohnbare Biosphäre im Glimmer-System darstellte, ergab sich daraus die Schlussfolgerung eines Needlecasts in stellaren Dimensionen …
Nur wohin?
Ich blickte auf. Von der Betondecke kam das grelle Licht darin eingelassener Neonröhren. Ich saß in einem aufgeklappten Zylinder aus mattem Metall und sah aus wie ein altertümlicher Flugzeugpilot, der vergessen hatte, sich etwas anzuziehen, bevor er in seinen Doppeldecker gestiegen war. Der Zylinder stand mit etwa zwanzig weiteren an der Wand aufgereiht, gegenüber einer schweren verschlossenen Stahltür. Die Luft war kühl, die Wände hatten keinen Anstrich. Auf Harlans Welt, das musste man den Leuten lassen, waren zumindest die Resleevingräume in beruhigenden Pastellfarben gehalten, und das Personal verhielt sich freundlich. Schließlich hatte man seine Schuld gegenüber der Gesellschaft beglichen. Das Mindeste, was man erwarten konnte, war ein netter Start in ein neues Leben.
»Nett« gehörte jedoch nicht zu den Attributen des Kerls, der vor mir stand. Er war etwa zwei Meter groß und machte den Ein- druck, als hätte er seinen Lebensunterhalt damit verdient, gegen Sumpfpanther zu kämpfen, bevor er sich für eine andere Berufslaufbahn entschieden hatte. Die Muskulatur wölbte sich wie ein Hornpanzer über Brust und Arme, der Kopf war kahl rasiert, und eine lange Narbe zuckte wie ein Blitz über den Schädel und schlug in das linke Ohr ein. Er trug ein weites, schwarzes Gewand mit Schulterstücken und einem Disketten-Logo auf der Brust. Seine Augen passten zur Kleidung und beobachteten mich mit stählerner Ruhe. Nachdem er mir geholfen hatte, mich aufzusetzen, war er bis auf Griffweite zurückgewichen, als würde es exakt so in den Vorschriften stehen. Diesen Job machte er schon seit längerer Zeit.
Ich hielt mir ein Nasenloch zu und beförderte schnaubend die Reste des Gels aus dem anderen.
»Würden Sie mir verraten, wo ich bin? Mich über meine Rechte aufklären oder etwas in der Art?«
»Kovacs, im Augenblick haben Sie überhaupt keine Rechte.« Ich blickte auf und sah, dass sich sein Gesicht zu einem grimmigen Lächeln verzogen hatte. Ich reagierte mit einem Achselzucken und säuberte die rechte Nasenhöhle.
»Würden Sie mir trotzdem verraten, wo ich bin?«
Er zögerte einen Moment, blickte zur Neonstaffel in der Decke auf, als müsste er sich noch einmal der Informationen vergewissern, bevor er sie weitergab, dann erwiderte er mein Schulterzucken.
»Klar. Warum nicht? Sie sind in Bay City, Kumpel. Bay City auf der Erde.« Dann stellte sich wieder sein Grimassenlächeln ein. »Der Heimat der Menschheit. Genießen Sie Ihren Aufenthalt auf der ältesten aller zivilisierten Welten. Tätäräh!«
»An Ihnen ist ein Entertainer verloren gegangen«, sagte ich mit völlig ernster Miene.
Die Ärztin führte mich durch einen langen weißen Korridor, dessen Fußboden die Spuren vieler gummibereifter Rollbahren trugen. Sie legte ein ziemliches Tempo vor, und ich musste mich anstrengen, um Schritt zu halten. Immerhin trug ich nicht mehr als ein schlichtes graues Handtuch am Leib und war immer noch klitschnass vom Gel. Sie bemühte sich um ein entspanntes Arzt-Patient-Verhältnis, obwohl ihre Art etwas Gehetztes hatte. Sie hatte sich ein Bündel Unterlagen in Form sich wellender Ausdrucke unter den Arm geklemmt und schien noch weitere Termine zu haben. Ich fragte mich, wie viele Sleevings sie täglich zu betreuen hatte.
»Sie sollten sich in den nächsten ein oder zwei Tagen möglichst viel Ruhe gönnen«, sagte sie auf. »Wenn Sie stellenweise leichte Schmerzen verspüren, ist das kein Grund zur Beunruhigung. Durch viel Schlaf lösen sich diese Probleme von ganz allein. Falls Sie dauerhafte Beschwerden …«
»Ich weiß. Ich bin nicht zum ersten Mal in einer solchen Situation.«
Dieses Gespräch machte auf mich kaum den Eindruck einer zwischenmenschlichen Interaktion. Ich hatte mich gerade an Sarah erinnert.
Wir blieben vor einer Tür stehen, auf dessen Milchglasscheibe das Wort Dusche gedruckt war. Die Ärztin dirigierte mich hinein und sah mich einen Moment lang an.
»Es ist auch nicht das erste Mal, dass ich eine Dusche benutze«, versicherte ich ihr.
Sie nickte. »Wenn Sie fertig sind, nehmen Sie den Aufzug am Ende dieses Korridors. Ein Stockwerk höher werden die Entlassungsformalitäten geregelt. Vorher würde sich die … äh … die Polizei gerne mit Ihnen unterhalten.«
In den Vorschriften hieß es, dass man es unterlassen sollte, frisch gesleevte Individuen stärkeren nervlichen Belastungen auszusetzen. Vermutlich hatte sie meine Akten gelesen und betrachtete es angesichts meines Lebensstils nicht als außergewöhnliches Ereignis, mit der Polizei zu tun zu haben. Ich versuchte es genauso zu sehen.
»Worüber?«
»Man zog es vor, mich darüber nicht in Kenntnis zu setzen.« Ihre Worte verrieten, dass sie deswegen leicht verärgert war – eine Regung, die sie mir eigentlich nicht hätte offenbaren dürfen. »Vielleicht ist Ihnen Ihr Ruf vorausgeeilt.«
»Vielleicht.« Ich folgte einem spontanen Drang und verzog mein neues Gesicht zu einem Lächeln. »Doktor, ich bin noch nie hier gewesen. Auf der Erde, meine ich. Ich hatte noch nie mit Ihrer Polizei zu tun. Sollte ich mir deswegen Sorgen machen?«
Als sie mich ansah, erkannte ich die aufwallenden Gefühle in ihren Augen, die Mischung aus Furcht, Erstaunen und Verachtung, wie sie typisch für jemanden war, der die Menschen verbessern wollte und damit gescheitert war.
»Wenn es um einen Mann wie Sie geht«, brachte sie schließlich heraus, »hätte ich gedacht, dass es die Polizei ist, die sich Sorgen machen sollte.«
»Stimmt«, sagte ich leise.
Sie zögerte kurz, dann zeigte sie nach hinten. »Im Ankleideraum gibt es einen Spiegel«, sagte sie und ging. Ich drehte mich um und warf einen Blick in die Richtung, aber ich war mir noch nicht sicher, ob ich schon für den Spiegel bereit war.
Unter der Dusche vertrieb ich meine Unruhe durch unmelodisches Pfeifen, während ich meinen neuen Körper mit Händen und Seife säuberte. Mein Sleeve war Anfang vierzig, Protektoratsstandard, mit der Figur eines Schwimmers, und das Nervensystem schien auf militärische Anforderungen zugeschnitten zu sein. Wahrscheinlich durch ein neurochemisches Upgrade. Dem hatte ich mich selber schon einmal unterzogen. Die Lungen wiesen eine gewisse Kurzatmigkeit auf, die auf Nikotinabhängigkeit hindeutete, und der Unterarm wurde von prächtigen Narben geziert. Doch davon abgesehen stellte ich nichts fest, worüber ich mich hätte beschweren können. Die kleineren Mängel und Schwächen fielen einem erst im Laufe der Zeit auf, und wenn man klug war, lernte man einfach damit zu leben. Jeder Sleeve hatte eine Geschichte. Wer sich daran störte, sollte sich in die Schlangen vor Syntheta oder Fabrikon einreihen. Ich hatte schon mehrere synthetische Sleeves getragen. Sie wurden häufig bei Bewährungsverhandlungen benutzt. Sie waren billig, aber man hatte meistens den Eindruck, allein in einem zugigen Haus zu leben, und anscheinend schafften sie es nie, die Schaltkreise für die Geschmacksnerven richtig zu verdrahten. Alles, was man aß, schmeckte letztlich wie gewürzte Sägespäne.
In der Umkleidekabine lag ein ordentlich zusammengefalteter Sommeranzug auf der Bank, und in die Wand war ein Spiegel eingelassen. Auf der Kleidung hatte man eine einfache Armbanduhr aus Stahl und einen weißen Umschlag deponiert, auf dem mein Name geschrieben stand. Ich atmete tief durch und stellte mich dem, was der Spiegel mir zeigen würde.
Das war jedes Mal der schwierigste Moment. Obwohl ich es schon seit zwei Jahrzehnten machte, versetzte es mir immer wie- der einen Schock, wenn ich plötzlich das Gesicht eines Fremden erblickte. Es war, als würde man ein Bild aus den Tiefen eines Autostereogramms hervorziehen. In den ersten Momenten sah man nur jemanden, der in einem Fensterrahmen stand und einen betrachtete. Dann verschob sich die Wahrnehmung und man spürte, wie man den Raum hinter der Maske ausfüllte und an die Innenseite gepresst wurde, was ein beinahe körperlich spürbares Schockerlebnis war. Als hätte jemand eine Nabelschnur zerschnitten, nur dass nicht zwei Menschen voneinander getrennt wurden; es war die Andersartigkeit, die abgeschnitten wurde, bis man erkannte, dass man sein eigenes Spiegelbild betrachtete.
Ich stand vor dem Spiegel und rieb mich mit dem Handtuch trocken, während ich mich an das Gesicht zu gewöhnen versuchte. Der Körper hatte weiße Hautfarbe, was für mich etwas Neues war, und mein nachhaltigster Eindruck war der, dass dieser Sleeve niemals den Weg des geringsten Widerstands gegangen war. Selbst mit der charakteristischen Blässe eines längeren Aufenthalts im Tank wirkten die Gesichtszüge wettergegerbt. Überall waren Falten. Das dicke, kurz geschnittene Haar war schwarz mit grauen Einsprengseln. Die Augen hatten einen nachdenklichen Blauton, und über dem linken war eine schwache gezackte Narbe. Ich hob den linken Unterarm und betrachtete die Geschichte, die darauf niedergeschrieben war. Ob beide etwas miteinander zu tun hatten?
Der Umschlag unter der Armbanduhr enthielt ein einzelnes Blatt bedruckten Papiers. Handsigniert. Sehr originell.
Tja, du bist jetzt auf der Erde. Der ältesten aller zivilisierten Welten. Ich zuckte die Achseln und überflog den Brief, dann zog ich mich an und steckte ihn zusammengefaltet in die Jacke meines neuen Anzugs. Mit einem letzten Blick in den Spiegel legte ich die Armbanduhr an und machte mich auf den Weg zur Polizei.
Es war vier Uhr fünfzehn Ortszeit.
Richard Morgan: „Altered Carbon – Das Unsterblichkeitsprogramm“ ∙ Roman ∙ Aus dem Englischen von Bernhard Kempen ∙ Wilhelm Heyne Verlag, München 2017 ∙ 608 Seiten ∙ Preis des E-Books € 8,99 (im Shop)



Kommentare