Das Monster und die Überfrau
Robert Silverbergs „Der Gesang der Neuronen“ handelt von Außenseitern und ihrer schmerzhaften Emanzipation
Ein Mann, der von einem fremden Planeten als Monstrosität zurückgekehrt ist – und eine Jungfrau, die die Mutter von hundert Babys wurde. Beide könnten unterschiedlicher nicht sein und werden genau deshalb von Duncan Chalk, dem Betreiber eines Unterhaltungsimperiums, zusammengebracht, um ihre Geschichte medial auszuwerten. Doch der ohnehin alles andere als menschenfreundliche Chalk verfolgt noch einen weiteren und bedeutend dunkleren Plan. Mit dem Hugo-nominiertem Klassiker „Der Gesang der Neuronen“ („Thorns“; im Shop) aus dem Jahr 1967 hat Robert Silverberg ein Buch über Außenseiter geschrieben, die buchstäblich unter Schmerzen zu sich selber finden.
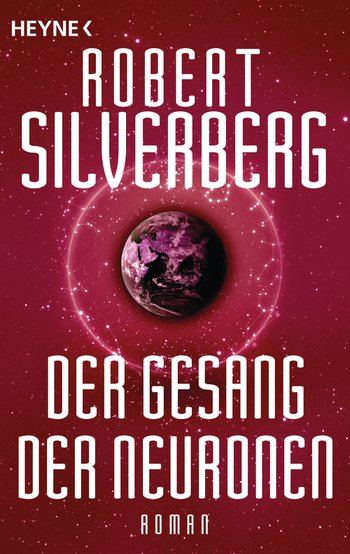 „Dort draußen sind Wesen, die uns einfangen und von Grund auf verändern.“ Der vierzigjährige Minner Burris weiß, wovon er spricht. Seit seinem Erkundungsflug zum Planeten Manipool, den er als einziger der Crew überlebt hat, ist sein Anblick für Menschen nur schwer zu ertragen. Zahlreiche physische Veränderungen künden von den Fähigkeiten fremdartiger Chirurgen, die ihn aus unbekannten Gründen „verbessert“ und damit zu einer Monstrosität gemacht haben. Einerseits entdeckt er immer wieder faszinierende neue Eigenschaften an sich; so kann er nun erheblich besser sehen und womöglich fünfhundert Jahre alt werden. Anderseits leidet er aber beständig unter gravierenden Schmerzen und dem niederschmetternden Eindruck totaler Isolation. Nichts wäre Minner Burris lieber, als wieder ein normaler Mensch zu sein.
„Dort draußen sind Wesen, die uns einfangen und von Grund auf verändern.“ Der vierzigjährige Minner Burris weiß, wovon er spricht. Seit seinem Erkundungsflug zum Planeten Manipool, den er als einziger der Crew überlebt hat, ist sein Anblick für Menschen nur schwer zu ertragen. Zahlreiche physische Veränderungen künden von den Fähigkeiten fremdartiger Chirurgen, die ihn aus unbekannten Gründen „verbessert“ und damit zu einer Monstrosität gemacht haben. Einerseits entdeckt er immer wieder faszinierende neue Eigenschaften an sich; so kann er nun erheblich besser sehen und womöglich fünfhundert Jahre alt werden. Anderseits leidet er aber beständig unter gravierenden Schmerzen und dem niederschmetternden Eindruck totaler Isolation. Nichts wäre Minner Burris lieber, als wieder ein normaler Mensch zu sein.
Genau dies stellt ihm der schwerreiche Duncan Chalk in Aussicht, dessen Vergnügungskonzern das halbe Sonnensystem umspannt. Als Gegenleistung verlangt und erhält er die exklusiven Verwertungsrechte an Burris‘ Geschichte. Dann bringt er ihn – zufällig, wie es scheint – mit der siebzehnjährigen Lona Kelvin zusammen, die auf den ersten Blick unauffällig erscheint, jedoch durch eine massive Eizellenspende zur Mutter von einhundert Babys wurde und seither von sich selbst entfremdet ist. Chalk verspricht ihr, dass sie zwei ihrer Kinder zu sich nehmen darf, wenn sie sich um Burris kümmert. Sein Kalkül geht auf – die auf den ersten Blick so gegensätzlichen, doch innerlich so verwandten Seelen verlieben sich ineinander. Aber während einer medial neugierig begleiteten Reise, die die beiden über den Erdtrabanten bis hin zum kolonisierten Saturnmond Titan führt, kommt es zu Konflikten, die ein immer größeres Ausmaß annehmen. Duncan Chalk ist nämlich auch eine Art Telepath, der fremde Gefühle zu lesen versteht – und den nichts mehr ergötzt als das Leiden anderer.
Mit „Der Gesang der Neuronen“ leitete Robert Silverberg 1967 die zweite und wohl wichtigste Schaffensphase in seiner produktiven Schriftstellerkarriere ein, die erst 1976 mit „Schadrach im Feuerofen“ enden sollte. Nachdem er zunächst handelsübliche Unterhaltung und danach zahlreiche Sachbücher geschrieben hatte, verblüffte „Der Gesang der Neuronen“ mit einem ungewöhnlichen Plot und ernstzunehmenden Charakteren, deren Entwicklung das eigentliche Thema des Romans ist. Silverberg umreißt eine in vielen Dingen optimierte Welt, in der Krankheiten und Umweltzerstörung weitgehend der Vergangenheit angehören, bevölkert sie aber mit Figuren, die durchgehend innerlich verletzt sind. Burris‘ Deformation ist nur der drastische Ausdruck einer Versehrtheit, der auch Lona Kelvin unterliegt. Beide müssen sich erst dazu durchringen, sich trotz aller inneren Widerstände als das zu akzeptieren, was sie sind. Dies geht nicht ohne Mühen, doch genau diese sind unverzichtbar – „Schmerz ist lehrreich“, heißt es bezeichnenderweise in der ersten und in der letzten Zeile des Buches, dessen Originaltitel „Thorns“ (Stacheln, Dornen) zwar auf Burris‘ Leidenschaft für Kakteen anspielt, aber auch den Hauptkonflikt des Buchs umreißt. Gegenüber der Selbstemanzipation spielt das Thema der medialen Ausbeutung eine erheblich geringere Rolle, als aus heutiger Sicht zu erwarten wäre. Allerdings würde ohne Chalks vampirartige Neigung, Schwäche auszubeuten und sich von fremden Emotionen zu ernähren, der Plot nicht funktionieren.
Silverberg fand mit „Der Gesang der Neuronen“ zu Themen, die ihn nachhaltig beschäftigen sollten. In „Exil im Kosmos“ (1968; im Shop) wurde die Hauptfigur von Außerirdischen psychisch „modifiziert“, was sie in eine Außenseiterposition bringt, während „Es stirbt in mir“ (1972, im Shop) von einem Telepathen handelt, der seine Gabe allmählich verliert. „Der Gesang der Neuronen“ hat also durchaus den Charakter einer Keimzelle. Und wem das noch nicht reicht: Der deutsche Elektronikpionier Klaus Schulze bezeichnete 1973 eines der Stücke seines vielbeachteten zweiten Albums „Cyborg“ mit dem Titel „Neuronengesang“. Eine freundliche Verbeugung, die auch aus heutiger Sicht vollkommen nachvollziehbar ist.
Robert Silverberg: Der Gesang der Neuronen • Roman • Aus dem Amerikanischen von Elke Kamper • Wilhelm Heyne Verlag, München 2017 • E-Book: € 4,99 (im Shop)



Kommentare