Was liest man in der Wolfszone?
Literarische Referenzen, Tribute und Helden in der nahen Zukunft
Ich mag es, wenn in Büchern gelesen wird. Wenn eine Figur in einem Roman oder einer Story ein Buch aufklappt und in der Fiktion etwas anderes liest. Gar nicht mal so sehr wegen des Meta-Levels von Literatur in der Literatur, sondern zuallererst, weil es schlicht meine Welt abbildet, meine eigene Wirklichkeit wiedergibt. Leben und Lesen. Lesen und Leben.
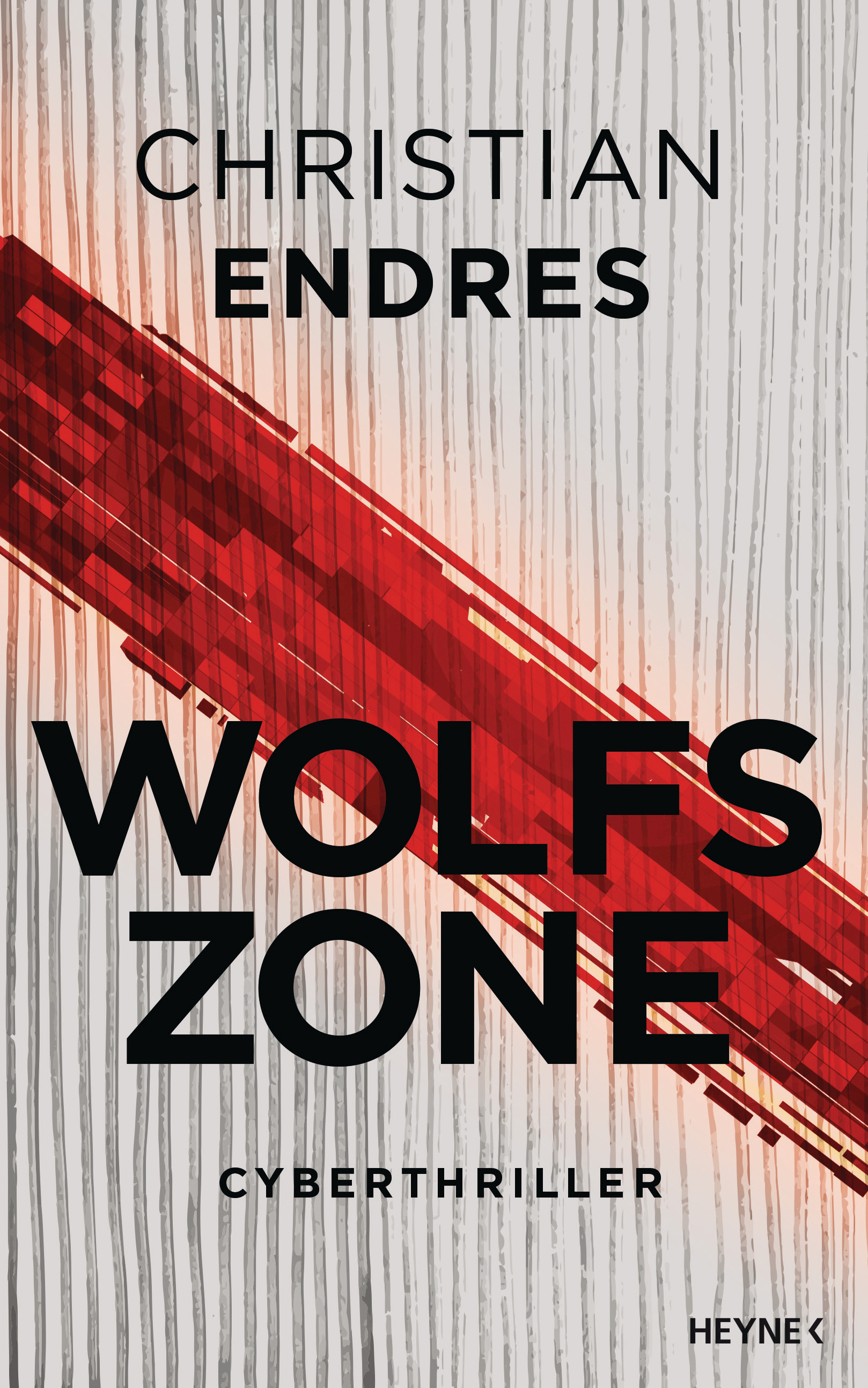 Zu sagen, dass Bücher einen großen Bestandteil meines Lebens ausmachen, wäre noch untertrieben. Ich lese viel, in gewisser Weise immerzu. Literatur beherrscht im Alltag viele meiner Gedanken und Tätigkeiten. Bücher sind außerdem permanent um mich herum, und zwar in rauen Mengen: sie quellen aus den Regalen, stapeln sich im Arbeitszimmer, vor dem Nachttisch, im Flur, auf dem Wohnzimmer-Sofa. Und zu Menschen, die ebenfalls einen Hang zu Büchern und zum Lesen haben, baue ich hin und wieder schneller eine Connection auf, wie ich festgestellt habe.
Zu sagen, dass Bücher einen großen Bestandteil meines Lebens ausmachen, wäre noch untertrieben. Ich lese viel, in gewisser Weise immerzu. Literatur beherrscht im Alltag viele meiner Gedanken und Tätigkeiten. Bücher sind außerdem permanent um mich herum, und zwar in rauen Mengen: sie quellen aus den Regalen, stapeln sich im Arbeitszimmer, vor dem Nachttisch, im Flur, auf dem Wohnzimmer-Sofa. Und zu Menschen, die ebenfalls einen Hang zu Büchern und zum Lesen haben, baue ich hin und wieder schneller eine Connection auf, wie ich festgestellt habe.
Außerdem – um zum Anfangsgedanken über das Lesen in Literatur und über Bücher in Büchern zurückzukommen – wollen wir doch alle wissen, was unsere literarischen Lieblingscharaktere so lesen, und damit letztlich ihre Erfinderinnen und Schöpfer. Gerade im Krimi-Bereich fällt mir der literarische Tribut regelmäßig auf. Selbst bei Giganten wie Stephen King (im Shop) oder Joe R. Lansdale (im Shop). Manchmal verraten sie einem in ihren Geschichten ewige oder aktuelle Lieblingswerke, manchmal verweisen sie unterstützend auf Freunde und Kolleginnen. Dadurch entsteht auch ein gewisses Gemeinschaftsgefühl – zwischen den Schreibenden, aber auch zwischen Lesenden und Schreibenden. Wir bewegen uns alle in derselben Welt, navigieren anhand desselben Referenzmaterials. Plus: Was gibt es Schöneres, als ein gutes Buch zu verschlingen, und darin entweder eine Parallele zum eigenen literarischen Gusto zu finden, oder sogar ein neues Buch zu entdecken, das man prompt Leseliste oder SUB hinzufügt?
Auch in meinem gerade erschienenem Roman „Wolfszone“ (im Shop), über dessen Hintergründe und Entstehung hier mehr zu erfahren ist, tippe ich mir ein paar Mal an den imaginären Hut (bzw. die konkrete Mütze), erweise ich anderen Schreibenden und ihrem Schaffen die Ehre. In ein paar Szenen über die nahe Zukunft der Cyborg-Wölfe an der deutsch-polnischen Grenze geht es mir in Nebensätzen, selbstverständlich ganz bewusst, um schreibende Favoriten, Heldinnen und Vorbilder, um literarische Ehrerbietung und um die Weitergabe guter Literatur.
Das fängt schon damit an, dass Protagonist und Privatdetektiv Joe Denzinger in „Wolfszone“ früh von einer anderen Figur gefragt wird, ob sein Name auf den deutschen Architekten Franz Josef von Denzinger (1821–1894) zurückgeht. Joe kann das nicht wirklich beantworten, ich als Autor schon. Denn in Wahrheit ist die Namensableitung vom Kirchenbaumeister viel mehr eine Referenz an den amerikanischen Krimi-Maestro Michael Connelly und dessen längst multimedialen Ermittler Harry Bosch, der seinen Namen Hieronymus Bosch wiederum dem berühmten niederländischen Maler verdankt. Den Namen Joe Denzinger hatte ich früher im Manuskript als das Spiel mit dem Dombaumeister, aber dass sich so ein Wink in Richtung Michael Connelly und Harry Bosch ergab, war mir mehr als Willkommen.

Dasselbe gilt für Don Winslow (im Shop). Er wurde zum Namenspaten für Winslow, den zahmen Wolf der Biologin Kira, die am Rande der Sperrzone als Wissenschaftlerin für die Bundeswehr tätig ist, zu ihrem tierlieben Leidwesen. Winslow ist da häufig ihr Lichtblick. Kira erklärt Joe im Roman bei ihrem ersten Zusammentreffen, dass Winslow seinen Namen von US-Krimi-Genie Don Winslow hat, dessen Bücher die Forscherin schätzt. Als ich 2021 die Erstfassung von „Wolfszone“ schrieb, wusste ich noch nicht, dass mein Krimi im Mai 2024 nun keine Woche vor der deutschsprachigen Erstausgabe von Don Winslows allerletztem Roman „City in Ruins“ erscheinen würde, dem Abschluss der Danny-Ryan-Trilogie, mit der Don Winslow just seine große Karriere beendet hat, um sich fortan ganz dem Kampf gegen Trump und Co. zu widmen.
Müsste ich die Handvoll Autorinnen und Autoren benennen, die den größten Einfluss auf mein Schaffen hatten, dann wären das wohl J. R. R. Tolkien (im Shop), Arthur Conan Doyle (im Shop), Terry Pratchett (im Shop), Neil Gaiman (im Shop), Robin Hobb (im Shop) und eben Don Winslow. Fiction im coolen, unmittelbaren Präsens schreiben, stylishe Sätze und kurze Absätze zimmern, Ecken und Kanten bewahren, Dialoge möglichst echt klingen lassen – dass ich die meisten meiner Romane und Kurzgeschichten seit über einem Jahrzehnt so schreibe, hat viel mit Don Winslow zu tun, dessen Roman „Zeit des Zorns“ von 2010 in dieser Hinsicht ein Game-Changer für mich war. Die Winslow-Referenz in „Wolfszone“ ist daher ebenso viel Tribut wie ewiges Dankeschön aus der Ferne.
Und ja, es fühlt sich ein Stück weit surreal an, wenn mich dieser Tage Fotos erreichen, wo „Wolfszone“ von Christian Endres und ein aktueller Danny-Ryan-Roman von Don Winslow in einem Thalia nebeneinander auf dem Krimi-Neuheiten-Tisch liegen …
Von den Krimi-Novitäten zu den Krimi-Klassikern. Die Anspielungen auf Sherlock Holmes und Philip Marlowe in „Wolfszone“ sind vermutlich selbsterklärend, verweisen sie doch auf die großen, definierenden, allgegenwärtigen Detektive von Arthur Conan Doyle und Raymond Chandler, beide jeweils Mitbegründer und prägende Gestalten einer eigenen Detektivkrimi-Schule, die bis in unsere Zeit überdauern. Sherlock Holmes hat mich mit 12, 13 zum Krimi gebracht und wird immer eine meiner Lieblingsfiguren sein, ob ich lese oder schreibe; Philip Marlowe stellt für mich, seit ich ihn mit 17 oder 18 zum ersten Mal getroffen habe, bis heute den Prototypen des modernen Schnüfflers, irgendwo zwischen zynischem Ritter und unbelehrbarem Romantiker, immer gut zu kanalisieren, interpretieren. Joe ist meine Variation dieses Typus, ein Stück vom Original weg, und doch zweifellos verbunden.
Im nahzukünftigen Setting von „Wolfszone“ liebevoll-sarkastisch oder ironisch auf diese beiden Ermittler-Legenden anzuspielen, ist ein unverzichtbarer Fingertipp an den Deerstalker bzw. den Fedora (zu diesem Hut hat Joe im Roman ja ein ambivalentes Verhältnis, von wegen: Klischee in der Welt der Detektive einerseits, essenzieller Sonnenschutz in der klimakrisen-gebeutelten Welt von Morgen andererseits).
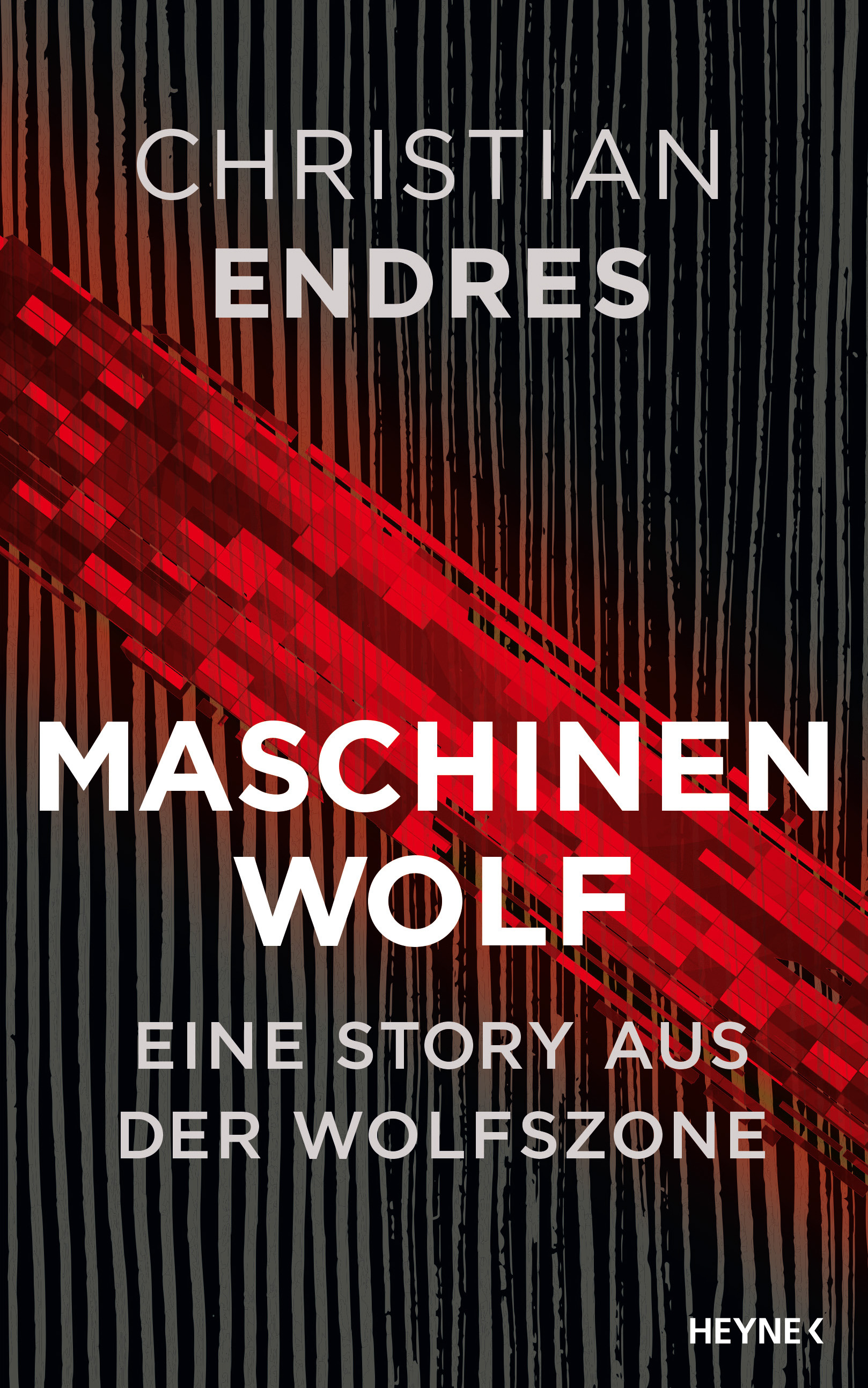 Doch in „Wolfszone“ werden auch neuere Bücher gelesen, die es bei uns heute noch gar nicht gibt. Ziemlich am Anfang liefert Fahrradkurierin (und Drogenschmugglerin) Marija für die kleine Buchhandlung in Dölmow, dem letzten Dorf vor der Sperrzone, einen neuen Roman von US-Autorin Ivy Pochoda aus. Und im Camp von ProW@lf vor der Zone liest Aktivist Helge, Ex der verschwundenen, von Joe gesuchten Lisa Kraupen (siehe auch das kostenlose E-Book-Prequel „Maschinenwolf“; im Shop) einen Science-Fiction-Roman von Becky Chambers. Als sich diese beiden Stellen beim Verfassen von „Wolfszone“ auftaten und ich zwei Schreibende highlighten konnte, wollte ich mit dem Krimi und der SF nicht bloß die Genres würdigen, die „Wolfszone“ zu dem Buch machen, das es nun mal ist.
Doch in „Wolfszone“ werden auch neuere Bücher gelesen, die es bei uns heute noch gar nicht gibt. Ziemlich am Anfang liefert Fahrradkurierin (und Drogenschmugglerin) Marija für die kleine Buchhandlung in Dölmow, dem letzten Dorf vor der Sperrzone, einen neuen Roman von US-Autorin Ivy Pochoda aus. Und im Camp von ProW@lf vor der Zone liest Aktivist Helge, Ex der verschwundenen, von Joe gesuchten Lisa Kraupen (siehe auch das kostenlose E-Book-Prequel „Maschinenwolf“; im Shop) einen Science-Fiction-Roman von Becky Chambers. Als sich diese beiden Stellen beim Verfassen von „Wolfszone“ auftaten und ich zwei Schreibende highlighten konnte, wollte ich mit dem Krimi und der SF nicht bloß die Genres würdigen, die „Wolfszone“ zu dem Buch machen, das es nun mal ist.
Mir war zudem wichtig, Autorinnen zu nennen, die ich seit ein paar Jahren wahnsinnig gern lese, die mich mit jedem ihrer Bücher beeindrucken, und von denen ich mir als Fan wie als Kollege definitiv vorstellen kann, dass sie auch in zehn, fünfzehn, zwanzig Jahren noch schreiben – und gelesen werden, mit ihren dann womöglich klassischen ersten oder ihren dann hoffentlich neuesten Werken. So haben Ivy Pochoda und Becky Chambers ihren Weg in meine Geschichte gefunden. Pochoda z. B. aufgrund ihres grandiosen Romans „Visitation Street“, der zu meinen liebsten Noir-Sommerromanen gehört und den ich kurz vor Beginn der Arbeit an „Wolfszone“ mit großem Vergnügen gelesen hatte; und Chambers wegen der späteren Bände ihrer „Wayfarer“-Space-Opera, die ich damals ebenfalls just goutiert hatte.
Vor und nach dem Showdown von „Wolfszone“ werden indessen noch mal zwei Krimi-Könner ins Rampenlicht gerückt, deren Romane ich hoch in Ehren halte: Der Amerikaner Dennis Lehane und der Schotte Ian Rankin (im Shop). Meine Lieblingsbücher von Mr. Lehane aufzuzählen, würde ausarten, ganz oben in der Hitliste stehen die Fälle von Kenzie und Gennaro ab „Ein letzter Drink“, und dazu „Im Aufruhr jener Tage“, „Am Ende einer Welt“ und „Mystic River“. Und Ian Rankin … seinen John Rebus aus Edinburgh habe ich, wie Michael Connellys Harry Bosch aus L. A., erst kurz vor deren fiktivem Eintritt in den Polizisten-Ruhestand kennengelernt. Allerdings könnte ich mir ein Krimi- oder Leseleben ohne Rebus mittlerweile genauso wenig vorstellen wie ohne Bosch. Schlachtrösser und Veteranen, und dennoch der Goldstandard. (Michael Connelly droppt in seinen Romanen mit Vorliebe die Titel von Jazz-Stücken, by that way, und Ian Rankin alte Rock- und Punk-Bands.).
Für die Szene, in der ich Mr. Lehane erwähne, hatte ich komplett freie Hand, um einen meiner Faves zu benennen, nur Krimi musste es sein. Was würde ein Buchhändler in Wolfssprungweite der von der Bundeswehr abgeriegelten Zone am Arsch von Brandenburg, der auf Krimi spezialisiert ist und ein Stück weit meine literarischen Vorlieben vertritt, wohl als Lieblingsroman in einer ruhigen Minute im Laden lesen? Da musste ich nicht lange nachdenken, bis ich den Namen Dennis Lehane eintippte, gut möglich, dass mich im Entstehungszeitraum von „Wolfszone“ eine Neuaugabe eines „Kenzie und Gennaro“-Filets ins Schwärmen brachte. (Übrigens ist Gerhard Sterbach, der Name des furchtlosen Buchhändlers aus Dölmow in „Wolfszone“, ein Gruß an Gerd Eibach und Bernhard Sterner, zwei befreundete Buchhändler aus meiner Heimatstadt Würzburg, die mich schon mehr als mein halbes Buchmenschen-, Comicnerd- und Fantasten-Leben begleiten).

Die Erwähnung von Mr. Rankin und seinem John Rebus, fast schon im Epilog meines Buches, folgte unterdessen erneut der Überlegung, welche von mir gefeierte Krimiserie man in der nahen Zukunft noch in den (oft kleineren) Bahnhofsbuchhandlungen finden würde. Ursprünglich war’s an der Stelle Conelly/Bosch, aber nachdem diese Referenz zwischenzeitlich bereits durch Joes Namen abgedeckt war und ich während des Schreibens und Überarbeitens von „Wolfszone“ eine Handvoll Rebus-Romane gelesen habe, machte ich im Verlauf eines Politurdurchgangs Rankin/Rebus daraus.
Das sind also die literarischen Referenzen und Tribute in meinem Near-Future-Krimi, den ich nicht hätte schreiben können ohne die vielen Bücher, die mich wie Trittstreine an diesen Punkt gebracht haben. Ich bin mir sicher, dass ich in meinem nächsten Roman wieder ein paar literarische Anspielungen und Verneigungen dieser Art einbauen werde (so, wie ich es früher auch schon in meinen Sherlock-Holmes-Geschichten häufig und gern getan habe). Mal sehen, welche Darlings es dann „erwischt“.
Natürlich hoffe ich, dass Fans von Don Winslow, Ivy Pochoda, Ian Rankin und Co. bei der Lektüre von „Wolfszone“ etwas finden werden, das sie ebenfalls mögen – ein Zeichen für eine unvermeidliche literarischen Osmose, und für eine kreative Genre-Verwandtschaft. Gewachsene Verbindungen innerhalb der Literatur, ob Krimi oder Science-Fiction, die man beim Lesen einfach spürt, die „Wolfszone“ mit anderen Werken im Wald der Fiktion verknüpfen, und die uns alle zum Teil eines lesenden, Bücher jagenden, gute Geschichten verschlingenden Rudels machen.
Christian Endres: Wolfszone • Roman • Heyne, München 2024 • 512 Seiten • Erhältlich als Hardcover und eBook • Preis des Hardcovers: 20,00 € • im Shop
Christian Endres: Maschinenwolf • Kurzgeschichte • Heyne, München 2024 • Gratis-eBook • im Shop

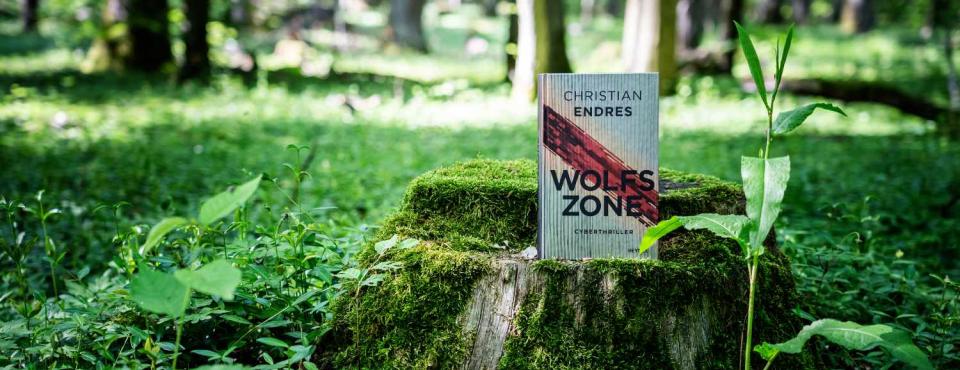

Kommentare