„Die leuchtende Republik“ – Das Leben der Anderen
Andrés Barbas über den Tod von Kindern und die Ignoranz der Erwachsenen
Kinder, Jugendliche, die jenseits der Welt der Erwachsenen leben und sich selbst verwalten. Unweigerlich muss man bei dieser Beschreibung an William Goldings Klassiker „Herr der Fliegen“ denken. Andrés Barbas spielt in seinem kurzen, intensiven Roman „Die leuchtende Republik“ (im Shop) mit diesen und anderen Bezügen, hat aber doch einen ganz anderen Roman geschrieben. Denn nicht aus der Sicht von Kindern wird erzählt, sondern aus der eines namenlosen erwachsenen Erzählers, der zudem mit einem Abstand von zwei Jahrzehnten auf die Ereignisse zurückblickt.
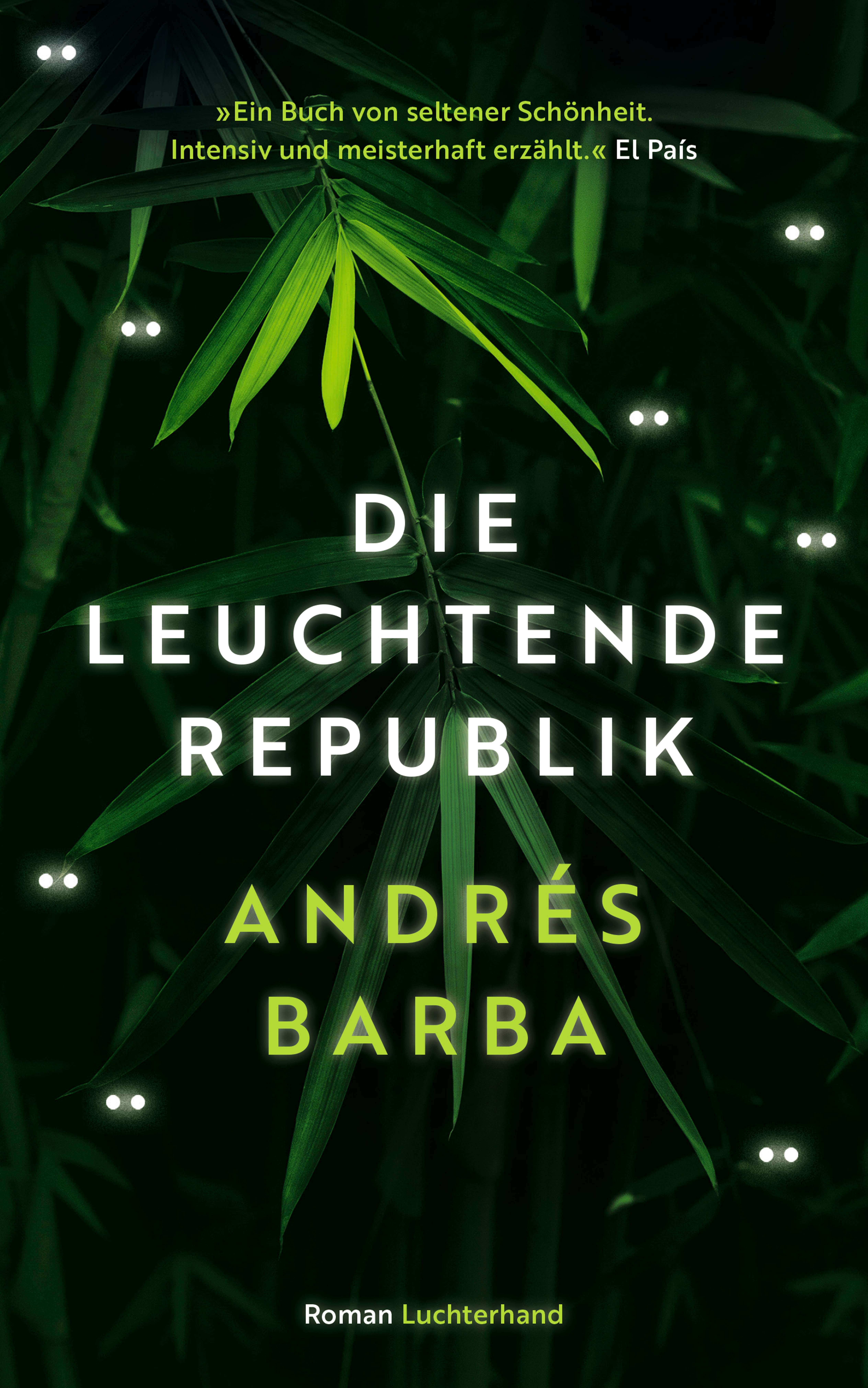 32 Kinder sind einst, so beginnt der Erzähler seinen Bericht, seine Erinnerungen, Mitte der Neunziger Jahre, in Santo Cristóbal getötet worden, einer mittelgroßen Stadt, in einem fiktiven Land in Südamerika. Ausgerechnet als Beamter, der ein Programm zur Integration indigener Gemeinschaften entworfen hat, kam der Erzähler einst in die Stadt, zusammen mit seiner Frau Maia und deren Tochter. Beschaulich und friedlich scheint das Leben abgelaufen zu sein, bis die Kinder auftauchten. Plötzlich waren sie da, stahlen aus Abfalleimern, bald auch aus Geschäften, lebten erst auf der Straße, dann irgendwo im nahen Dschungel. Anfangs dachten die Bewohner, dachten die Erwachsenen sich noch nicht viel dabei, allein das ihre eigenen Kinder sich zunehmend von den Außenseitern angezogen fühlten, sorgte für Irritation. Bis dann eines Tages die Kinder einen Supermarkt überfielen und zwei Erwachsene töteten.
32 Kinder sind einst, so beginnt der Erzähler seinen Bericht, seine Erinnerungen, Mitte der Neunziger Jahre, in Santo Cristóbal getötet worden, einer mittelgroßen Stadt, in einem fiktiven Land in Südamerika. Ausgerechnet als Beamter, der ein Programm zur Integration indigener Gemeinschaften entworfen hat, kam der Erzähler einst in die Stadt, zusammen mit seiner Frau Maia und deren Tochter. Beschaulich und friedlich scheint das Leben abgelaufen zu sein, bis die Kinder auftauchten. Plötzlich waren sie da, stahlen aus Abfalleimern, bald auch aus Geschäften, lebten erst auf der Straße, dann irgendwo im nahen Dschungel. Anfangs dachten die Bewohner, dachten die Erwachsenen sich noch nicht viel dabei, allein das ihre eigenen Kinder sich zunehmend von den Außenseitern angezogen fühlten, sorgte für Irritation. Bis dann eines Tages die Kinder einen Supermarkt überfielen und zwei Erwachsene töteten.
In klarer, unmittelbarer Sprache beschreibt Barbas die Ereignisse, lässt die Erinnerung seiner Hauptfigur oft wie einen möglichst neutralen Bericht über lange zurückliegende, aber immer noch unerklärliche Ereignisse wirken. Und doch hängt der Schatten des magischen Realismus über seiner Prosa, verstärkt durch die bewusst reduzierte Perspektive des Erzählers.

Immer wieder zitiert dieser zwar Dokumentarfilme oder Zeitungsberichte, die über die seltsamen Ereignisse gedreht oder geschrieben wurden, erwähnt auch eine linguistische Studie, die die Geheimsprache der Kinder zu entschlüsseln versuchte. Rationale Versuche von Erwachsenen sind das, die Welt der Kinder, die Welt der Anderen zu begreifen.
Inspiriert hat sich Barbas, der in seiner spanischen Heimat zu den renommiertesten Autoren seiner Generation zählt, vom polnischen Dokumentarfilm „The Children of Leningradsky“, der 2005 für den Oscar als bester kurzer Dokumentarfilm nominiert war. Um Kinder, die nach dem Zerfall der Sowjetunion in einer U-Bahn-Station in Moskau leben ging es dort, um eine Art Parallelwelt, die nach eigenen Regeln funktionierte und von Außen kaum zu verstehen war.
An einer Stelle im Roman ist die Rede von „der zwangsläufigen Verachtung gegenüber dem, was man nicht versteht“ die Rede, womit nicht zuletzt der Blick der europäischen Kolonialherren auf die indigene Bevölkerung Südamerikas beschrieben werden könnte. Unterschwellig spielt Barbas auch darauf an, wenn er seinen Erzähler auch Jahrzehnte später rätseln lässt, was damals passiert ist. Man mag es für unbefriedigend halten, das Vieles, eigentlich fast Alles im unklaren bleibt, doch gerade diese Rätselhaftigkeit lässt „Die leuchtende Republik“ zu einer irritierenden, fesselnden Fabel werden, deren Sog man sich kaum entziehen kann.
Andrés Barba: Die leuchtende Republik • Roman • Aus dem Spanischen von Susanne Lange • Luchterhand, München 2022 • 224 Seiten • Erhältlich als Hardcover und eBook • Preis des Hardcovers: 22,00 Euro • im Shop



Kommentare