Im Gespräch mit „Providence“-Autor Max Barry
Falsche Götter vor und nach der Pandemie
Seit 20 Jahren schreibt der Australier Max Barry (im Shop) außergewöhnliche Romane, die sich oftmals mit dem systematischen Wahnsinn des Fortschritts in allen Bereichen unseres Lebens beschäftigen – etwa in den Science-Fiction-Büchern „Logoland“ oder „Maschinenmann“. Seine Coca-Cola-Satire „Sirup“ wurde 2013 sogar mit Shiloh Fernandez und Amber Heard in den Hauptrollen verfilmt. Aber der 1973 geborene Barry wirkte auch schon an dem von ihm miterfundenen Online-Game „NationStates“ und diversen Software-Projekten mit. Sein neuester Roman „Providence“ ist soeben bei Heyne auf Deutsch erschienen. Das innovativ verfasste SF-Buch handelt davon, dass es nach dem Erstkontakt zwischen den Menschen und den außerirdischen ‚Salamandern’ zum galaktischen Krieg kommt. Den führt die Menschheit in der nahen Zukunft mit gewaltigen Kriegsraumschiffen, die von einer passend großen und autonomen künstlichen Intelligenz gelenkt werden – die vier Crew-Mitglieder an Bord der ‚Providence’ sind daher eigentlich nur für die Propaganda von der Front im All zuständig. Dann aber stellt sich heraus, dass nicht bloß die Aliens eine große Gefahr bedeuten, sondern auch die Entscheidungen der nicht weniger fremdartigen KI des Schiffs. Im Interview spricht Max Barry, der mit seiner Familie in Melbourne lebt, über die Corona-Pandemie in Australien, das langwierige Ausgraben von Ideen sowie eine bedenkliche Zukunft der gottgleichen Konzerne und künstlichen Intelligenzen.

Hallo Max. Wie haben du und deine Lieben die Covid-19-Pandemie bisher überstanden? Um ehrlich zu sein, lag Australien nicht im Fokus der Berichterstattung deutscher Medien …
Australien ist nicht so sehr Teil der Pandemie gewesen! Wir haben den Rest der Welt ausgesperrt, sogar unsere eigenen Staatsbürger – bis zum heutigen Tag versuchen noch immer 30.000 Australier, nach Hause zu kommen. Wir lassen sie nicht rein, weil wir zu große Angst davor haben, das Virus zu entfesseln. Diejenigen von uns, die bereits hier gewesen sind, hatten Glück und genossen in den letzten 18 Monaten viele Freiheiten, aber deshalb schreitet das Durchimpfen auch nur sehr langsam voran, weil die Leute das Gefühl haben, dass es keinen Grund zur Eile gibt. Gerade sind wir also in einer recht gefährlichen Situation mit 90% der Bevölkerung, die nichtgeimpft sind. Ich bin mir nicht sicher, wann Australier jemals wieder in die Welt hinaus dürfen.
Hat das alles deine Sicht der Welt, deine Denkweise als Science-Fiction-Autor verändert?
Ich denke, dass die echte Welt science-fiction-mäßiger geworden ist. Ich habe von einer Theorie gehört, laut derer Menschen, die Science-Fiction lesen, besser auf Naturkatastrophen vorbereiten sind, weil wir uns wieder und wieder eine radikal veränderte Welt vorstellen – ich bin mir aber nicht sicher, ob das stimmt. Doch die Wirklichkeit fühlt sich manchmal wie etwas aus einem Buch an. Mit der Pandemie hat sich alles sehr schnell verändert, also fängt man an zu denken, dass sie sich erneut verändern könnte, in völlig unerwartete Richtungen. Was sowohl aufregend als auch beängstigend ist.
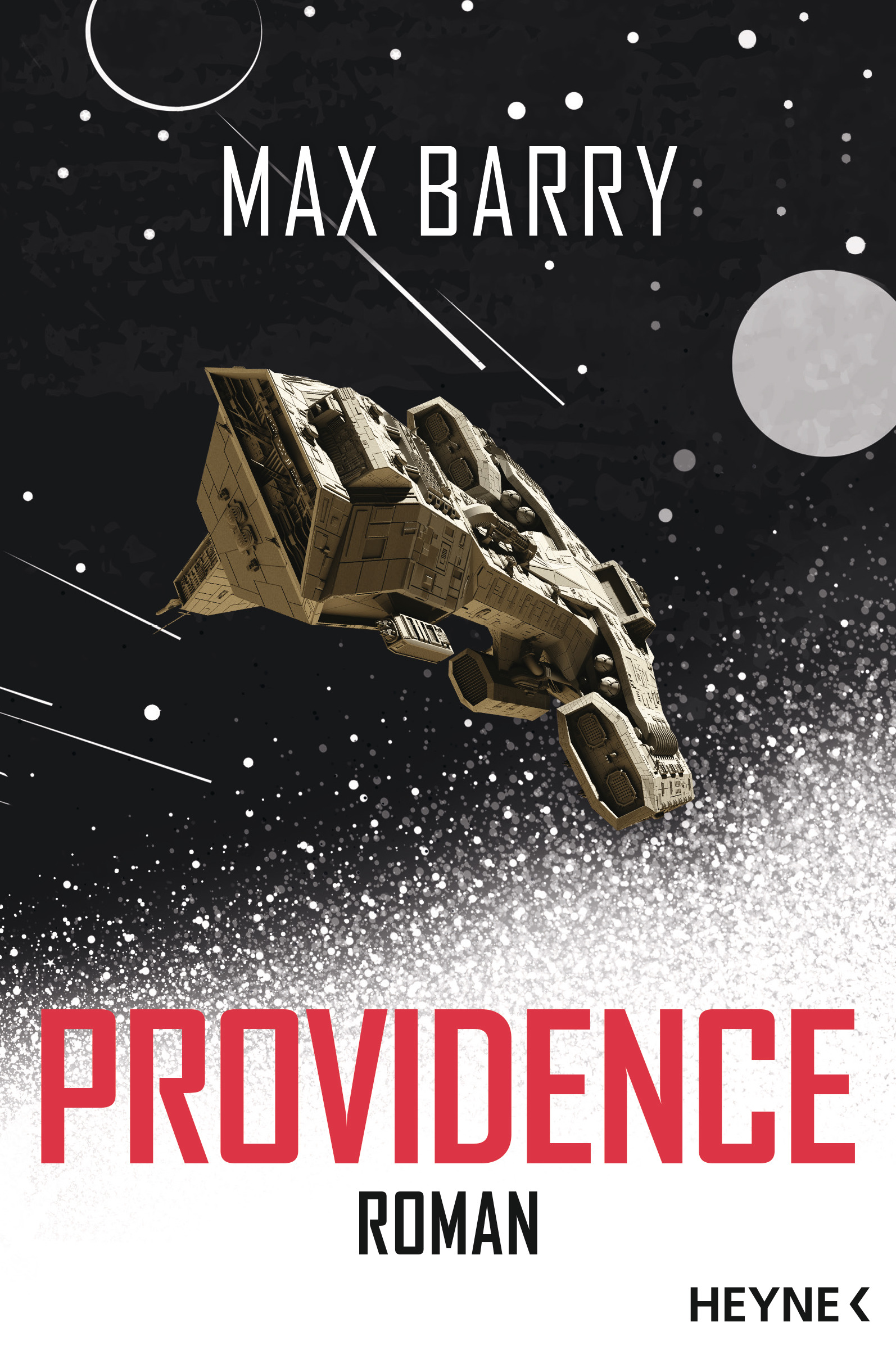 In deinem Bestseller „Logoland“ von 2002 beherrschen Konzernriesen die Welt. Amazon ist einer der Gewinner der Pandemie, mächtiger als je zuvor. Ist es unheimlich, dass die Realität mit deiner Science-Fiction gleichzieht?
In deinem Bestseller „Logoland“ von 2002 beherrschen Konzernriesen die Welt. Amazon ist einer der Gewinner der Pandemie, mächtiger als je zuvor. Ist es unheimlich, dass die Realität mit deiner Science-Fiction gleichzieht?
Ich wünschte, die Leuten würden es unheimlich finden! Es erstaunt mich, dass Konzerne jedes Jahr mächtiger werden und wir nichts dagegen tun. Wir haben mindestens ein halbes Dutzend globaler Firmen, die vor ein paar Dekaden sofort zerschlagen worden wären, weil sie ihre Marktmacht überschritten haben und eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen. Damit meine ich Apple, Google und Facebook im Besonderen. Doch niemand schlägt noch so etwas vor. Würdest du es anregen, würden die Leute argumentieren, dass es unfair gegenüber diesen Firmen wäre, da wir die Idee akzeptiert haben, dass sie echte Personen mit Gefühlen und Persönlichkeiten sind, und keine ökonomischen Instrumente. Also befinden wir uns bereits in einem Zeitalter, in dem wir einfach hoffen, dass mächtige Konzerne gut zu uns sein werden, anstatt dass wir sie auf sinnvolle Weise in ihrem Tun einschränken.
Lass uns über deinen neuen Roman „Providence“ reden, der ein Stück weit von einer Kurzgeschichte inspiriert wurde, die du auf der High School geschrieben hast. Reaktivierst du oft Ideen von früher mit deinem heutigen Können?
Die Kurzgeschichte hat nicht wirklich etwas mit dem Roman gemein, abgesehen von meiner Liebe für Science-Fiction. Aber ich tendiere dazu, Ideen so lange zu überarbeiten, bis sie sich in etwas Interessantes verwandeln. Das erste Kapitel eines Buches schreibe ich dutzende Male mit verschiedenen Perspektiven und Ansätzen, bis ich es richtig hinbekomme. Und oft braucht es dafür fünf Jahre oder länger, in denen ich immer und immer wieder zu ihm zurückkehre. Ich habe das Gefühl, dass in der Nähe eine interessante Story begraben liegt, aber es kann lange dauern, bis ich sie ausgegraben habe.
Ein Kritiker feierte „Providence“ als Alien trifft Starship Troopers. Wenn du einen Haupteinfluss auf den Roman herausstellen müsstest, welcher wäre das?
Es ist schwer, einen herauszupicken. Ich beziehe mich sicher auf eine Kindheit, in der ich actionreiche, enthusiastische „gung ho“ Science-Fiction-Romane geliebt habe. Normalerweise sind meine Bücher eher „Ideen-Sci-Fi“ statt „Ding-Sci-Fi“ – sie sind in der echten modernen Welt angesiedelt und enthalten keine futuristische Technologie. Doch mir gefiel stets die Idee, eines Tages ein vollblütiges Weltraum-Abenteuer zu schreiben, mit Raumschiffen im Kampf gegen Aliens. Ich wartete bloß auf eine Geschichte, die mich das auf eine neue und interessante Weise tun lassen würde.
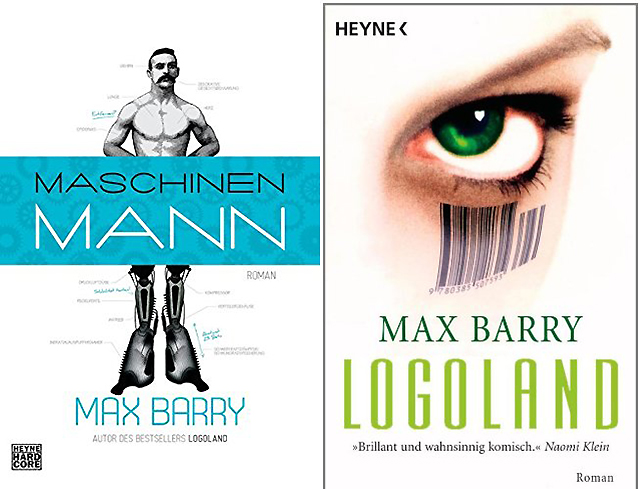
In „Maschinenmann“ ging es darum, dass Mensch und Maschine verschmelzen, und trotz der Symbiose die Menschlichkeit bewahrt wird. In „Providence“ dreht sich alles um künstliche Intelligenz, die wir nie verstehen können. Was wird in der Zukunft essenzieller sein? Die Symbiose, oder mehr Skepsis gegenüber den Göttern, die wir nicht kontrollieren können?
Meines Erachtens haben wir bereits die Götter geschaffen, die wir nicht kontrollieren können: Konzerne. Sie leben länger als die Menschen, die für sie arbeiten; und sie sind größer, als die Summer ihrer einzelnen Teile. Ich denke, das passt ganz natürlich zu der Vorstellung von künstlicher Intelligenz, denn in beiden Fällen reden wir von künstlichen Lebensformen, die kein Gehirn haben sollten, jedoch in der Lage sind, auf überraschend intelligente und feindselige Weise zu handeln. Ich sehe eine Zukunft voraus, in der Konzerne und künstliche Intelligenz untereinander austauschbar sein werden. Wie in „Providence“, wo es schwer ist, den Unterschied zwischen einer Firma und der von ihr genutzten KI zu erkennen.
Wieso hast du Providence als Namen für das Raumschiff und als Titel deines Romans gewählt? Es hat vermutlich nichts mit Lovecraft zu tun, obwohl der auch über große, nichtfassbare und nichtmenschliche Entitäten schrieb …
Das Wort Providence wird im Englischen oft in einem religiösen oder spirituellen Sinn verwendet, um die Idee zu beschreiben, dass eine gütige Macht unser Leben lenkt und dafür sorgt, dass am Ende alles gut ausgeht. Was im Roman die KI des Raumschiffes ist. Und die offensichtliche Frage lautet: Ist es wirklich gütig? Trifft es dieselbe Entscheidungen, die ich treffen würde? Auf der einen Seite ist es ziemlich behaglich, zu denken, dass eine mächtige Entität über dich wacht; doch es ist auch eine Bevormundung – ihr habt eine Kind-Eltern-Beziehung, in der du darauf vertrauen sollst, dass sie weiß, was am Besten für dich ist. Viele von uns wollen ihr Schicksal selbst bestimmen – wir machen lieber unsere eigenen Fehler statt einem schmalen Pfad zu folgen, den jemand anderes für uns ausgewählt hat. Und das ist, was uns erwartet in der Ära der super-intelligenten Apps, Programme und Geräte, die in vielen Dingen wirklich besser sind als wir.
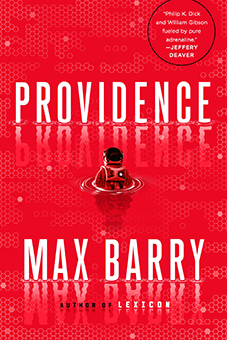
Im Roman gibt es eine Stelle, an der die Crew weiß, dass sie für lange Zeit den Kontakt zur Erde verlieren wird. Wie würdest du dich in so einer Phase beschäftigen?
Als Autor verliere ich tatsächlich für lange Zeitspannen den Kontakt mit der Welt. Ich habe fast nicht mitbekommen, dass eine Pandemie tobt, weil ich das Haus ohnehin so gut wie nie verlasse. Ich bin also wie die Figur Gilly in „Providence“, der kein Problem mit der Isolation hat. Doch während des Lockdowns – der in meiner Heimstadt sehr strikt war und 112 Tage dauerte – fiel mir auf, dass ich Telefonanrufe und Nachrichten von Menschen bekam, von denen ich normalerweise nie höre. Sie saßen zuhause fest und sehnten sich verzweifelt nach Gesellschaft. Verschiedene Menschen reagieren unterschiedlich auf Stress.
Die Welt ist durch Corona auch wieder etwas kleiner und zugleich vernetzter geworden. Wie ist es eigentlich für dich, wenn du die internationalen und speziell die deutschen Ausgaben deiner Bücher siehst?
Heyne ist mutig, wenn es um Cover geht. Viele meiner Bücher haben in vielen Ländern dasselbe Titelbild-Design, aber in Deutschland will man fast immer sein eigenes Ding machen. Und das Cover-Design ist oftmals sehr ungewöhnlich. Ich freue mich stets darauf, das deutsche Cover zu sehen und herauszufinden, was man sich diesmal ausgedacht hat.
Das freut uns zu hören. Danke für das Gespräch, Max – bis zum nächsten Roman und Cover!
Max Barry: Providence • Roman • Aus dem Amerikanischen von Bernhard Kempen • Wilhelm Heyne Verlag, München 2021 • 400 Seiten • als Paperback und E-Book erhältlich • Preis des E-Books: € 11,99 • im Shop



Kommentare