„Junktown ist so eine Art DDR auf Speed“
Matthias Oden verrät im Interview, was ihn zu seinem Debütroman „Junktown“ inspiriert hat
Mit seinem Romanerstling hat Matthias Oden, seines Zeichens Journalist und Werbefachmann, eine so düstere wie packende Welt erschaffen. In einem fast nicht mehr wiederzuerkennenden Deutschland hat sich eine „Konsumrevolution“ ereignet, und jetzt sind die Zustände wieder so, wie sie bislang noch bei jedem utopischen Großprojekt hierzulande wurden: trostlos, bürokratisch und unmenschlich.
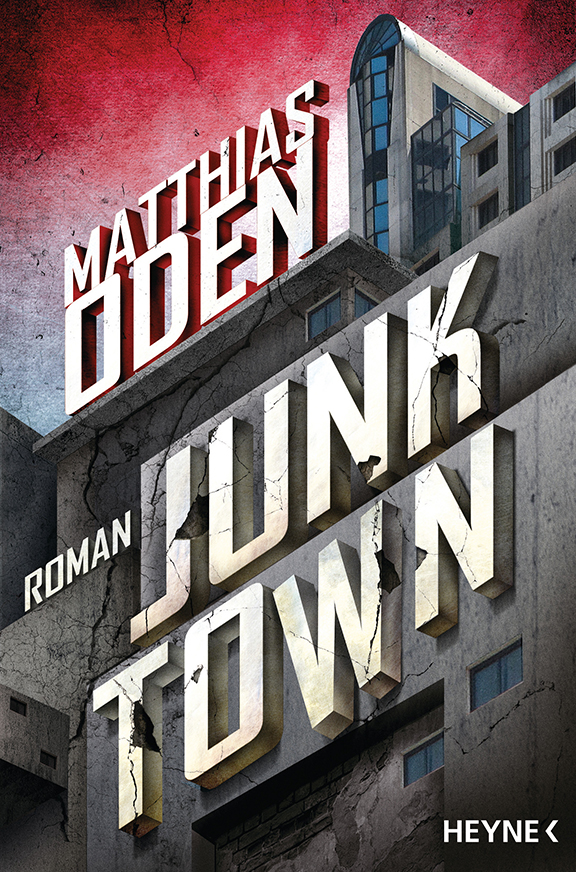 Diese Noir-Vision verpackt Oden allerdings so sprachgewaltig und selbstbewusst, dass selbst dem österreichischen Standard die Spucke wegbleibt: „Mit der Synthese von Technologie, Biologie, Pharmazeutik und totalitärer Politik macht der aus Werbung und Journalismus kommende deutsche Autor Matthias Oden sein dystopisches Gesellschaftspanorama Junktown zu einem einzigartigen Mix. Und zu einem Hammer-Debüt – genauer gesagt ist es ein Vorschlaghammer.“
Diese Noir-Vision verpackt Oden allerdings so sprachgewaltig und selbstbewusst, dass selbst dem österreichischen Standard die Spucke wegbleibt: „Mit der Synthese von Technologie, Biologie, Pharmazeutik und totalitärer Politik macht der aus Werbung und Journalismus kommende deutsche Autor Matthias Oden sein dystopisches Gesellschaftspanorama Junktown zu einem einzigartigen Mix. Und zu einem Hammer-Debüt – genauer gesagt ist es ein Vorschlaghammer.“
Im Exklusivinterview schildert Oden nun, welche literarischen Werke ihn geprägt und was ihn beim Schreiben von „Junktown“ (im Shop) beschäftigt hat:
– – –
diezukunft.de: Was hat Sie zur Geschichte von „Junktown“ inspiriert? Wie und wann entstand der erste Gedanke zur Handlung?
Matthias Oden: Ich mag Dystopien, und ich mag Geschichten, in denen Städte die eigentliche Hauptrolle spielen. China Miévilles New Crobuzon etwa aus „Perdido Street Station“ (im Shop) hat mich umgehauen. City 17 in „Half Life 2“ war ein Genuss. Aber es war Jeffrey Thomas’ „Punktown“, das mich dazu brachte, selbst eine Stadt zu entwerfen — was er da geschaffen hat, ist einfach großartig. Sein Punktown hat mit meinem Junktown wenig mehr gemeinsam als die Ähnlichkeit des Namens, aber ohne ihn hätte ich „Junktown“ wahrscheinlich nie geschrieben. Ähnlich wie die zwei wollte ich eine Stadt erschaffen, die sich nicht ganz klar in ein einziges (Sub-)Genre pressen lässt, und sie in ein unverbrauchtes Szenario hineinstellen. In der Zeit, als die Idee zu Junktown entstand, habe ich mich viel mit dem Versagen dessen beschäftigt, was sich internationale Drogenpolitik nennt. Dazu kam dann mein Interesse für deutsche Geschichte — und wenn man das alles zusammenschmeißt und noch ein bisschen Hunter S. Thompson draufpackt, dann kommt halt so etwas wie „Junktown“ raus.
diezukunft.de: Wie lange dauerte es bis zum fertigen Manuskript?
Matthias Oden: Das erste Mal habe ich Junktown in einer Kurzgeschichte betreten, die 2010 erschien. „Emo-Boy“ hieß die. Das Setting war deutlich unpolitischer und ein Großteil der Handlung spielte außerhalb der eigentlichen Stadt, aber die anderen wesentlichen Elemente — die Drogen, die Maschinen, der allgegenwärtige Verfall und die eher abgerockteTrostlosigkeit — die gab es damals schon. In dem Jahr darauf habe ich dann weitere Kurzgeschichten im Junktown-Setting geschrieben, die in meiner Schublade liegen, und in denen es zunehmend diktatorischer zuging. Irgendwann habe ich dann mit einem Roman angefangen. Aber es gab ewig lange Phasen, in denen ich gar nichts schrieb. Weil ich keine Lust hatte, aber auch, weil ich mir nicht sicher war, wie ich weitermachen sollte. Ich wusste immer schon, worum es gehen und wie das Buch enden sollte — den letzten Satz gab es vor dem ersten — aber eben nicht in allen Einzelheiten, wie ich da hinkommen würde. Aus dem Grund habe ich das Buch auch mal zwei Jahre am Stück liegen lassen. Die ersten hundert Seiten legte ich schließlich im Sommer 2015 der Agentur Simon vor, und die mochten es. Also nahmen sie es mit zur Buchmesse im November, und dort entschied sich Heyne, das Buch zu kaufen. Von da an habe ich den Rest geschrieben. Ein Großteil davon, knapp die zweite Hälfte etwa, ist in vier Wochen entstanden, in denen ich nichts anderes getan habe, als mich jeden Morgen hinzusetzen und bis abends zu schreiben. Deadlines sind wichtig für mich. Wenn Heyne das Manuskript nicht gekauft hätte, wäre ich wahrscheinlich noch heute nicht damit fertig.
diezukunft.de: In Junktown herrscht eine Diktatur des „Konsumismus“, Drogen sind Pflicht. Doch sorgt gerade das dafür, dass sich die meisten Bürger ganz von allein in eine unaufhaltsame Abwärtsspirale begeben, bis sie von der Partei fallen gelassen werden. Wie genau funktioniert dieses politische System?

© Sarah El-Wassimy
Matthias Oden: Das politische System in „Junktown“ hat sich aus einem Befreiungsgedanken heraus entwickelt: dem Menschen jeglichen Konsum zu erlauben und ihn in seiner vollständigen Entfaltung zu fördern. Irgendwann nach der sogenannten Konsumrevolution ist das Ganze dann gekippt und aus einem ursprünglich freiheitlichen Staat ist eine rigide Einparteiendiktatur geworden, die ihren Bürgern den Drogenkonsum vorschreibt. Dass das sich nicht unbedingt positiv aufs Bruttosozialprodukt auswirkt, liegt auf der Hand — die meisten Bürger Junktowns komatieren vor sich hin, unfähig, die Errungenschaften des einstmals hedonistischen Staatsideals — Drei-Tage-Woche, staatliche Grundversorgung etc. — wirklich zu genießen. Dafür funktioniert auch inzwischen viel zu wenig. Junktown ist so eine Art DDR auf Speed: Der Staat ist quasi im Eimer, verspricht aber noch immer das Paradies auf Erden. Dazu kommen deutliche Anleihen aus der anderen deutschen Diktatur, dem „Dritten Reich“. Es gibt etwa eine Gemapo, kurz für Geheime Maschinenpolizei, ein Rauschsicherheitshauptamt oder eine Kraft-durch-Konsum-Bewegung. Die Ähnlichkeiten mit dem NS-Regime bleiben auch nicht bei reinen Wortspielen: Der Alltag in „Junktown“ ist durchmilitarisiert, Uniformen sind allgegenwärtig, es gibt ein überbordendes Bürokratiechaos miteinander konkurrierender Ämter, und die Bürger werden nur noch als Verfügungsmasse des Staats begriffen, dem sie dienen. Dazu werden sie in Humanklassen eingeteilt und in regelmäßigen Ratings auf politische Linientreue und physische Verfassung hin geprüft. Wer in einem davon versagt, wird herabgestuft und ganz am Ende dem Recycling übergeben. So lange das Individuum noch die Aufgaben erfüllen kann, die der Staat ihm auferlegt, wird es gepampert. Danach wird recht schnell beim sozial verträglichen Ableben geholfen. Das ist ein Gedanke, der sich ähnlich auch in der nationalsozialistischen Leistungsmedizin findet.
diezukunft.de: In Junktown koexistieren intelligente Maschinenwesen und Menschen. Vor allem die Maschinen sind unverzichtbarer Bestandteil der Gesellschaft. Glauben Sie, dass über kurz oder lang auf die Menschheit komplett verzichtet werden kann? Dass also die Maschinen der Zukunft die besseren Menschen sind, eine Art Mensch 2.0?
Matthias Oden: Nein. Warum auch? Wir sind uns schließlich Selbstzweck. Wir können nicht auf uns verzichten, auch wenn das nicht heißt, dass man auf uns nicht verzichten könnte. Szenarien à la Skynet oder Matrix aber mögen extrem unterhaltsam sein oder als Basis für intellektuelle Gedankenexperimente dienen, die Angst vor einer unkontrollierbaren KI allerdings, der wir irgendwann im Weg sind, können wir, denke ich, getrost Elon Musk überlassen. Der Glaube an oder die Furcht vor einer KI hat doch jenseits des Fortschrittlich-Futuristischen etwas sehr Religiöses an sich. Das ist jetzt erstmal weder gut noch schlecht, nur eben eher kein Stoff für reales Zukunftsszenario. Aber dass wir uns mit und durch Maschinen besser machen? Bestimmt. Es gibt ja bereits Neuroprothesen, mit denen Gehörlose wieder hören können. In dieser Richtung werden wir noch mehr sehen, hoffentlich. In „Junktown“ wiederum sieht es ein bisschen anders aus: Die Gesellschaft ist auf die Maschinen angewiesen, weil sie eben im Drogenkoma vor sich hin sumpft. Maschinen sind keine Gerätschaften, mit denen man nach Vervollkommnung strebt oder körperliche Defizite ausgleicht. Maschinen sichern das Existenzminimum.
diezukunft.de: In Junktown gibt es Geräte, die die Bürger mittels Hirnwellenmessung identifizieren und orten können, aber Solomon Cain zum Beispiel kommuniziert über Notrufsäulen und schreibt seine Berichte auf einer Schreibmaschine. Woher nahmen Sie die Vorbilder für diese spezielle, fast schon retrofuturistische Ästhetik?
Matthias Oden: Ich wollte eine Atmosphäre schaffen, die stark von Verfall geprägt ist. Das geht schlecht, wenn alles so aussieht, als wäre es von Apple. Ein Look etwa wie in Gattaca hätte einfach nicht gepasst, und dann liegt so eine Retro-Optik eigentlich recht nahe. Außerdem besitzen für mich verfallene Industrieanlagen und Fabriken eine wahnsinnige Ästhetik. Ich mag dieses Morbide. Wenn ich allerdings einen Namen nennen muss, dann H.R.R. Giger. Ich verehre ihn. Seine biomechanische Kunst ist grandios. Die Maschinen in „Junktown“ haben zwar nicht Biologisches an sich, obwohl sie Menschen gebären können und Bürgerrechte besitzen. Aber auch sie sind roh und groß und düster. Da kann man sicherlich Gemeinsamkeiten sehen.
diezukunft.de: Gibt es denn eine Botschaft, die das Buch den Lesern vermitteln soll? Und wie stehen Sie selbst zu dieser Message?
Matthias Oden: Wer will, kann „Junktown“ als eine Auseinandersetzung mit Konsum und Freiheit betrachten. Es finden sich ebenso Zitate von Hunter S. Thompson auf den Seiten wie von der Weißen Rose oder Heinrich Himmler. Ich persönlich glaube, dass unsere heutige Drogenpolitik eine komplette Katastrophe ist und mehr Leid verursacht, als sie verhindert. Ihretwegen scheitern Staaten, gedeiht das organisierte Verbrechen, werden Drogensüchtige in die Kriminalität abgedrängt und verrecken auf irgendwelchen Bahnhofstoiletten. Der Wunsch des Menschen nach Exzess wird sich nie von Gesetzen eingrenzen lassen, und je früher wir damit anfangen, Drogen als gesundheitspolitisches Thema anzugehen statt als juristisches Problem, desto besser für uns. Auch wenn „Junktown“ letztlich den Schrecken einer Diktatur zeigt, in der Drogenkonsum Pflicht ist, und diese Überlegungen nur mittelbar auftauchen, hätte ich „Junktown“ ohne sie wohl nie geschrieben. Aber wer möchte, kann diesen ganzen Überbau auch komplett ignorieren. „Junktown“ funktioniert auch als Politthriller in einem leicht grotesken Setting.
diezukunft.de: Vielen Dank für das Gespräch!
– – –
Matthias Oden: Junktown ∙ Roman ∙ Wilhelm Heyne Verlag, München 2017 ∙ 400 Seiten ∙ E-Book: € 9,99 (im Shop)



Kommentare