Noch mal vor und nach dem „Jackpot“
Mit „Agency“ schreibt William Gibson seinen Erfolgsroman „Peripherie“ fort
Es ist nichts Geringes, wenn der Autor der „Neuromancer“- und der „Idoru“-Trilogie einen neuen Roman vorlegt – schließlich gehört William Gibson zu den noch immer wenigen SF-Autoren, die auch außerhalb des Genres beachtet werden. Mit „Agency“ kehrt er in das aus dem Vorgänger „Peripherie“ bekannte Universum mit künstlich geschaffenen Alternativwelten zurück und ersinnt einen Zeitstrang, in dem sich eine Katastrophe ganz eigener Art anbahnt, die droht, einen Großteil der Menschheit zu vernichten.
San Francisco im Jahr 2017. Das Angebot ist zu verlockend, um es abzulehnen: Als die gut vernetzte App-Flüsterin Verity Jane das Angebot erhält, eine neue Künstliche Intelligenz mit dem Namen „Eunice“ zu testen, lässt sie sich darauf ein, obwohl sie weiß, dass sie damit für die zwielichtige Firma Cursion arbeitet. Doch der Anfang ist überaus vielversprechend: Eunice lernt schnell, handelt rasch unabhängig und verfügt zudem über erstaunliche Kenntnisse. Für die sich auch andere interessieren, denn Verity wird überwacht. Als sie entdeckt, dass Eunice das Produkt eines militärischen Forschungsprojekts ist, versucht sie, das neu erworbene Wissen zurückzuhalten. Mit wenig Erfolg, denn plötzlich schweigt die KI. Wurde sie abgeschaltet?
Doch Verity lebt nicht in unserer Welt. Ihr Universum ist ein Stub (Stummel), der aus mehr als hundert Jahren Distanz künstlich erzeugt wurde und sich in einigen Dingen von der Hauptlinie unterscheidet – etwa mit den Details, dass eine Frau als Präsidentin der USA gewählt wurde und es den „Brexit“ nicht gibt. Doch die Aussichten sind düster. Zwar ist der „Jackpot“ – die „große anthropogene, systemische, multifaktorielle Scheiße“, wie es im Vorgänger „Peripherie“ heißt –, noch Jahrzehnte entfernt, doch die damit verbundene Auslöschung eines großen Teils der Menschheit kommt in Gestalt eines Nuklearkriegs erschreckend näher.
Verity erfährt dies von Wilf Netherton und seiner Chefin Ainsley Lowbeer, die im London des Jahres 2136 leben und das Bewusstsein der App-Flüsterin digital in ein Peripheral übertragen, einen Kunstmenschen, mit dem sie sich in der Zukunft bewegen kann. An der Themse hat sich so viel geändert, dass Verity zunächst glaubt, in ein Computerspiel geraten zu sein – die Folgen des „Jackpot“ konnten zwar technisch abgemildert werden, bleiben aber bestehen; außerdem wird das Land von einer autoritären Regierung beherrscht, deren Wurzeln im organisierten Verbrechen liegen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, in die Entwicklung des Stubs einzugreifen, um den drohenden Atomkrieg zu verhindern. Genau das wird Veritys Aufgabe, verfügt sie doch dank der Hilfe aus der Zukunft über genug „Agency“ („Handlungsmacht“), um eine Veränderung herbeizuführen.
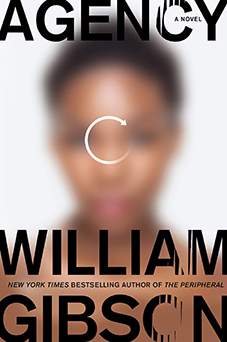 Nach dem gelungenen Roman „The Peripheral“ (2015; dt. „Peripherie“) war zu hoffen, dass der 1948 geborene William Gibson der gängigen Masche widersteht und den Roman nicht in Serie gehen lässt, aber die Versuchung dürfte zu groß gewesen sein; allein schon deswegen, weil keine neuen Themen erfunden werden müssen. „Agency“ erweist sich allerdings als schwache Fortführung. Dass Gibson ein mittelprächtiger Schriftsteller ist, sollte niemanden überraschen; zu oft erinnern seine Texte mit ihrer zweisträngigen Handlung, den kurzen pointenfixierten Kapiteln und ihrer Konzentration auf Dialoge an Produkte aus der Bestseller-Schreibwerkstatt. Was seine Bücher faszinierend macht und ihre spezifische Atmosphäre erzeugt, ist die rasche Taktung schillernder Einfälle. Doch davon hat „Agency“ viel zu wenige. Schon die Grundidee um eine Bloggerin, die mit einer künstlichen Intelligenz einen Nuklearkrieg verhindern soll, wirkt banal und abgedroschen; dazu kommt, dass es auch auf der Detailebene nicht besser aussieht: Am ehesten im Gedächtnis bleibt der hübsche Kniff, Einkaufstüten autonom in den Supermarkt zurückflattern zu lassen. Viel mehr ist Gibson nicht eingefallen; auch zum „Jackpot“ oder dem geheimnisvollen „chinesischen Server“, der die Zeitmanipulation erst möglich macht, erfährt man nichts Neues. Stattdessen sind die Bemühungen, den Stoff zu dehnen, unübersehbar. Das geht so weit, dass die Figuren des Londoner Erzählstrangs die Ereignisse im Stub, die nur wenige Seiten zuvor geschildert wurden, noch einmal zusammenfassen, als wenn irgendjemand – vielleicht der Autor selbst? – vor Langeweile den Anschluss verpasst hätte. Irgendwie müssen die 500 Seiten des Normformats „Bestseller“ ja gefüllt werden; künstlerische Erwägungen sind da wenig hilfreich. Gewiss kein Zufall, dass der Abgabetermin des Manuskripts mehrfach überzogen worden sein soll.
Nach dem gelungenen Roman „The Peripheral“ (2015; dt. „Peripherie“) war zu hoffen, dass der 1948 geborene William Gibson der gängigen Masche widersteht und den Roman nicht in Serie gehen lässt, aber die Versuchung dürfte zu groß gewesen sein; allein schon deswegen, weil keine neuen Themen erfunden werden müssen. „Agency“ erweist sich allerdings als schwache Fortführung. Dass Gibson ein mittelprächtiger Schriftsteller ist, sollte niemanden überraschen; zu oft erinnern seine Texte mit ihrer zweisträngigen Handlung, den kurzen pointenfixierten Kapiteln und ihrer Konzentration auf Dialoge an Produkte aus der Bestseller-Schreibwerkstatt. Was seine Bücher faszinierend macht und ihre spezifische Atmosphäre erzeugt, ist die rasche Taktung schillernder Einfälle. Doch davon hat „Agency“ viel zu wenige. Schon die Grundidee um eine Bloggerin, die mit einer künstlichen Intelligenz einen Nuklearkrieg verhindern soll, wirkt banal und abgedroschen; dazu kommt, dass es auch auf der Detailebene nicht besser aussieht: Am ehesten im Gedächtnis bleibt der hübsche Kniff, Einkaufstüten autonom in den Supermarkt zurückflattern zu lassen. Viel mehr ist Gibson nicht eingefallen; auch zum „Jackpot“ oder dem geheimnisvollen „chinesischen Server“, der die Zeitmanipulation erst möglich macht, erfährt man nichts Neues. Stattdessen sind die Bemühungen, den Stoff zu dehnen, unübersehbar. Das geht so weit, dass die Figuren des Londoner Erzählstrangs die Ereignisse im Stub, die nur wenige Seiten zuvor geschildert wurden, noch einmal zusammenfassen, als wenn irgendjemand – vielleicht der Autor selbst? – vor Langeweile den Anschluss verpasst hätte. Irgendwie müssen die 500 Seiten des Normformats „Bestseller“ ja gefüllt werden; künstlerische Erwägungen sind da wenig hilfreich. Gewiss kein Zufall, dass der Abgabetermin des Manuskripts mehrfach überzogen worden sein soll.
Natürlich lässt sich der Roman trotzdem lesen, und dem Verlag ist allein deswegen für die deutsche Ausgabe zu danken, weil Gibson trotz dieses Fehltritts ein wichtiger Autor bleibt. Dennoch: Wer neugierig geworden ist, liest zunächst besser „Peripherie“ oder greift zu den Klassikern wie der „Neuromancer“-Trilogie. Wagemutigen sei hingegen „Follower“ von Eugen Ruge empfohlen, der viel besser belegt, welche Möglichkeiten ein zeitgemäßer Cyberpunkroman wirklich hat. Auch wenn er nicht von William Gibson stammt.
William Gibson: Agency • Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Cornelia Holfelder-von der Tann und Benjamin Mildner • Tropen • 492 Seiten • € 25 • E-Book € 19,99

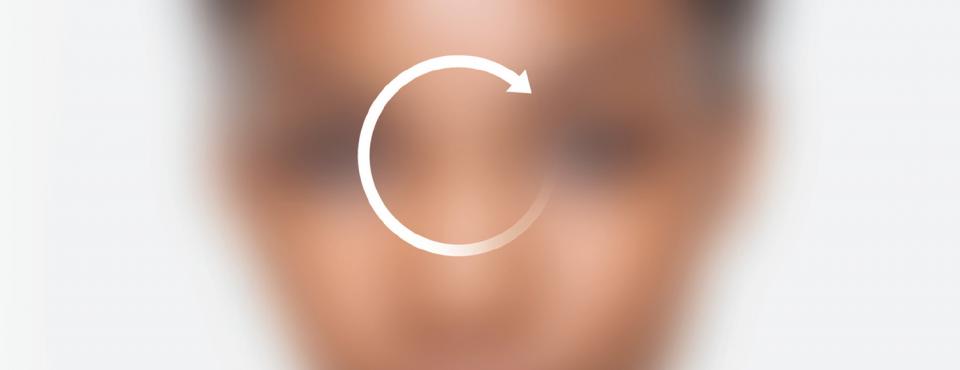

Kommentare