Aber es gilt nun einmal: Atlantis muss untergehen
Ein Gespräch mit Karlheinz Steinmüller
So kann‘s gehen: Ursprünglich wollten wir vom letztjährigen Stuttgarter Zukunftskongress Next Frontiers berichten, daraus wurde wegen Terminschwierigkeiten dann leider nichts. Also dachten wir, fragen wir stattdessen bei dem Gast, der uns am meisten interessiert hätte, Schriftsteller und Zukunftsforscher Karlheinz Steinmüller, wegen einem Interview an. Ein Volltreffer! Steinmüller gehört – zusammen mit seiner Frau Angela, mit der er oft zusammen schreibt – zu den ganz großen Namen im Science-Fiction-Bereich und war für zahlreiche Klassiker wie „Andymon“ oder „Pulaster“ verantwortlich, die seit 2014 in einer in Einzelausgaben veröffentlichten Gesamtausgabe im Memoranda-Verlag herausgegeben werden.
Aus dem E-Mail-Interview wurde ein reger Schriftverkehr, der wahrscheinlich noch einige Zeit weitergegangen wäre, wenn nicht einer dieser ewig Spaß bremsenden Abgabetermine um die Ecke gelauert hätte.

Wir interviewen zum ersten Mal jemanden, der sein ganzes Leben wirklich durch und durch der Zukunft gewidmet hat. Woher kommt dieses ausgeprägte Interesse an Morgen? Gab es ein Schlüsselerlebnis? Oder sind Sie einfach ausgesprochen neugierig zur Welt gekommen?
Anfang 1957 – ich war gerade sechs Jahre alt – hörte ich ein Hörspiel nach Jules Vernes Roman „Zwanzigtausend Meilen unter dem Meer“. Ich war fasziniert von der Technik und vor allem von einer Unterwasserwelt, die es erst noch zu erkunden gilt. Ähnlich fesselnd fand ich die beginnende Weltraumforschung. Sputnik 1 umkreiste die Erde. Die Menschheit weitet ihren Aktionsradius aus – das war die Zukunft! Ich verschlang alles, was ich damals in der frühen DDR an Science Fiction in die Hände bekam, aber auch jegliche Art von Sachbüchern über die Zukunft: Atomkraft, Roboter, Raumstationen. Eben hatte sich der Blick auf das Jahr 2000 geöffnet. Und ich würde dieses Wunderjahr erleben.
In diesem Zusammenhang: Wir haben erst die Tage über den unglaublich tollen Manga „GoGo Monster“ geredet, in dem sich vieles drum dreht, wie frei die Gedanken in jungen Jahren doch sind, und der bald, leider erst nach rund 20 Jahren, die deutschen Ufer erreicht. Da bringt der Protagonist, ein kleiner Junge namens Yuki, die Angst vieler Kinder in einem herrlichen Satz auf den Punkt: „Wenn man erwachsen wird, löst man sich im Inneren zu Brei auf und das Gehirn wird hart wie Stein.“ Und wenn wir ehrlich sind, Yuki hat nicht ganz Unrecht, viele Erwachsene zeichnen sich nicht gerade durch Fantasie und übermäßige Neugierde aus.
Wie haben Sie das beneidenswerte Kunststück vollbracht, sich Ihre Leidenschaft und vor allem diese Fantasie und diese permanente Neugierde auf das Morgen über die Jahrzehnte zu erhalten? Gab es zum Beispiel keinen Moment, in dem Sie mal dachten, eigentlich will ich gar nicht mehr wissen, was kommt, es wird ja doch nicht besser …?
Die großen Hoffnungen auf die „lichte Zukunft“ habe ich pünktlich mit dem Erwachsenwerden verloren, zuerst mit dem Ende des Prager Frühlings, dann mit der Diskussion um die Grenzen des Wachstums. Als wir Anfang der 1980er „Andymon“ schrieben, sahen wir die Zukunft der Menschheit schon sehr skeptisch. Ein kompletter Neuanfang wäre nötig, am besten mit unvorbelasteten Kindern. Inzwischen bin ich zu sehr Skeptiker, um Pessimist zu sein. Die Geschichte besteht aus überraschenden Wendungen. Es bleibt spannend, und man entdeckt immer wieder, wo man sich geirrt hat.
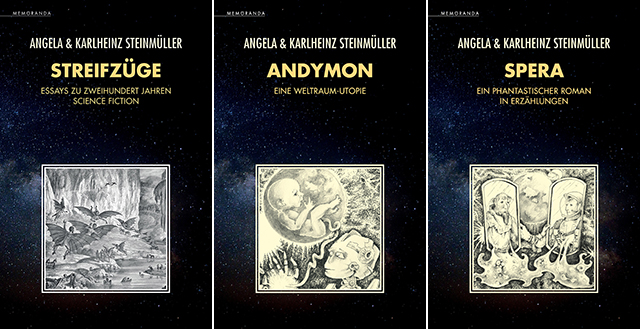
Noch eine Anmerkung zu Yuki. Als Jugendlicher hatte ich dieselbe Furcht. Eigentlich, überlegte ich, muss ich mich umbringen, bevor ich richtig erwachsen werde, also spätestens mit dreißig. Aber zugleich wusste ich schon, dass ich den Zeitpunkt verpassen würde. Jetzt sage ich mir: Mann, bloß gut, dass ich meinem Vorsatz untreu geworden bin!
Sie waren im letzten Jahr auf dem Kongress Next Frontiers in Stuttgart. Weil wir ganz aus der Nähe von Stuttgart kommen, müssen wir natürlich fragen: Wie haben Ihnen Stadt und Veranstaltung gefallen?
Es war immer dunkel: auf dem Weg vom Hauptbahnhof zum Hotel, mit der U-Bahn zum Veranstaltungsort und spät abends zurück. Aber von der Terrasse des Hauses der Architekten sah man ein breites und fast schon anheimelndes Panorama der Stadt. Unter Coronabedingungen musste der Kongress in einem stark reduzierten Format stattfinden, mit weniger Vorträgen und leider auch viel weniger Teilnehmern. Tobias Wengert, der Veranstalter, hatte trotzdem ein spannendes Programm mit Themen wie „post-fossil cities“ und „Hubots“ und „Wie viel Wirklichkeit lässt sich simulieren?“ zusammengestellt. Ich selbst saß in einem Podium über „Future Food“. Und Insektenriegel gab es auch. Dieses Jahr werde ich unbedingt wieder dabei sein.
Der Kongress war leider von einem Thema überschattet, an dem 2020 wohl niemand vorbeigekommen ist: Corona. Wie haben Sie es erlebt? Katastrophen dieser Art kannten wir bisher nur aus Science-Fiction-Geschichten. Wie ging es Ihnen?
Um im Hotel übernachten zu dürfen, musste ich mich testen lassen, was in der Kürze der Zeit nicht ganz einfach zu organisieren war. Kaum hatte ich aber den Test, war die Regelung aufgehoben, und ich brauchte ihn nicht mehr. Das eigentlich Spannende an der Pandemie sind die Veränderungen quasi über Nacht, die ständigen Anpassungen an die Situation, also die für alle gestiegene Ungewissheit.

Eine Pandemie ist für einen Zukunftsforscher und SF-Autor allerdings eine alte Bekannte, eigentlich ein alter Hut! Die SF-Literatur über Pandemien füllt seit Mary Shelleys „The Last Man“ (1826) ganze Regale. Seit über zwanzig Jahren habe ich auch eine Pandemie in meiner futurologischen Wild Card-Sammlung. Im Jahr 2003 haben Angela und ich außerdem „Die neue Pest“ in unser Buch über Wild Cards aufgenommen und über einen Zusammenbruch von Gesundheitssystem und Wirtschaft und ein Ende der Spaßgesellschaft, die damals gerade aktuell war, spekuliert. Auch ein Aufblühen der wahnwitzigsten Verschwörungstheorien hatten wir schon auf dem Radarschirm. Und 2011 habe ich gemeinsam mit Kollegen aus anderen EU-Ländern in einem Projekt einen „Killer-Virus“ auf Europa losgelassen. Der ist aber irgendwo in Brüssel steckengeblieben. Warnungen also gab es genug.
Einen „Killer Virus“, der in Brüssel steckengeblieben ist? Können Sie etwas mehr zu diesem Projekt sagen?
Das Projekt hatte den barocken Titel „iKnow – interconnecting knowledge through wild cards & weak signals“. Unsere Aufgabe bestand darin, mögliche Überraschungen (Wild Cards) und Anzeichen für Veränderungen (Weak Signals) zu identifizieren, die für den Europäischen Forschungsraum – also die Forschungsförderung der EU – wichtig sein könnten. Am Ende des Projekts publizierten wir u. a. 30 „policy alerts“, Themen mit hoher Priorität. „Killer Virus“ war dabei sogar die Nummer 1. Das Policy Alert Paper ist dann den gewohnten Gang durch die Brüsseler Entscheidungsgremien gegangen. Und ich habe nie von einer Reaktion gehört.
Wie wird die Zeit nach Corona? Wird es große Umwälzungen geben oder wird nach dem großen Schrecken alles wieder weitergehen wie zuvor?
Zukunftsforscher haben stets mehrere Szenarien. Meine Kollegen überschlagen sich mit kühnen Vorhersagen, mit utopischen Hoffnungen und düsteren Prognosen. Da steht die rasche Erholung neben der langen Depression, die Gesellschaft wird digital, nachhaltig, resilient umgebaut, die Menschen kehren dem Konsumzwang den Rücken und arbeiten für den Großen Reset der gesamten Wirtschaft. Ich selbst erwarte, dass zum Ende des Jahres sich das Leben dank erfolgreicher Impfkampagnen allmählich wieder normalisiert und bis 2024 sogar der Luftverkehr ungefähr das Vor-Corona-Niveau erreicht. Aber dann platzt vielleicht schon die nächste Wild Card über uns herein. Ich halte es aber auch nicht für völlig ausgeschlossen, wenn auch wenig wahrscheinlich, dass die Pandemie zum Dauerzustand wird, dass SARS-Cov2 uns auf Jahre hinaus mit immer neuen Varianten (also Mutationen) überrollt. In dem Fall würde in ein, zwei Jahren die Wirtschaft coronagerecht umgebaut werden, und wir müssten unsere Lebensweise – möglichst alles online, Tests, Masken, Tracking, Menschen stets auf Distanz – auf unabsehbare Zeit anpassen. Als Szenario ist das eine intellektuell reizvolle Aufgabe, aber so leben möchte ich natürlich nicht.

Sie hatten in Ihrem damaligen Buch über ein Ende der Spaßgesellschaft spekuliert. Glauben Sie, dass die Spaßgesellschaft aktuell ein Ende gefunden hat? Oder ist das nicht eher nur eine längere Pause? Wobei es im Grunde nicht mal die so wirklich gab, die Weihnachtstage haben ja eindrucksvoll gezeigt, dass viele Leute trotz 1000 Toten am Tag nicht gewillt sind, auf ihr Vergnügen zu verzichten. Wobei die Medien sicherlich auch gerne Minderheiten entsprechend aufwerten. Trotzdem: Was denken Sie? Wohin entwickeln wir uns gesellschaftlich, wenn Corona vielleicht nicht vorbei, aber zumindest zur grippeähnlichen Banalität geworden und der große Schock nur noch ein Spuk der Vergangenheit ist? Kann man Ihre Aussage, dass sich das Leben allmählich wieder normalisieren wird, so verstehen, dass auch gesellschaftlich alles so weitergehen wird, wie zuvor?
Historiker sagen, dass die großen Epidemien – Cholera, Typhus, die Spanische Grippe – relativ schnell verdrängt und vergessen wurden. Die Menschen wollen in ihr normales Leben zurückkehren, sich treffen, miteinander feiern, gemeinsam Spaß haben. Das ist bei uns Vertretern des Homo sapiens evolutionär tief angelegt. Damit sich für ein, zwei Generationen daran etwas ändert, müsste die Pandemie schon die Ausmaße des „Schwarzen Todes“ annehmen, an dem im 14. Jahrhundert ein Drittel der Bevölkerung Europas starb. Insofern wage ich die Prognose, dass die Muster unserer freizeitorientierten Konsumgesellschaft nach der Pandemie rasch zurückkehren – und wir hoffentlich auf die nächste Zoonose besser vorbereitet sind.
In der sehr lesenswerten – auf Ihrer Homepage abrufbaren – Kurzgeschichte „Cyber Munich“ gibt es VR-Brillen mit individuellem Stadtbild von München. Ist es ein mehr oder weniger ernst gemeinter Kompromiss für eine moderne Stadtgestaltung in einer Gesellschaft Ich-bezogener Menschen? Die Stadtverwaltung macht was sie will und die Bürger können sehen was sie wollen?
Nein, das war weder ernst gemeint noch ein Kompromiss. Die Story beruht auf zwei Ideen: Erstens, dass Menschen schon immer in zwei Städten lebten, einer realen und einer ihrer Wahrnehmung bzw. Vorstellung. Zweitens, dass die Wünsche der Menschen weit auseinanderklaffen, jeder sozusagen seine eigene Stadt haben will.
Oder könnte man dieser Geschichte auch als eine Art warnende Gesellschaftskritik verstehen? Immerhin nehmen wir ja spätestens mit dem Aufkommen der Smartphones mittlerweile alle unsere Umwelt verstärkt durch Monitore und durch eine von großen Firmen generierte Filterblase war? 2020 konnte man ja zudem auch prima beobachten, dass einige Menschen offenbar tatsächlich nur noch wahrnehmen, was sie wollen beziehungsweise was die virtuelle Welt im Internet diktiert. Was hat Sie zu dieser Geschichte inspiriert?

Viel banaler: Die Story war eine Auftragsarbeit für eine Publikation zum 25-jährigen Jubiläum der Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung. Bestimmte Themen und Motive wie Virtualisierung, Filterblasen, Realitätsverlust hat man allerdings immer im Hinterkopf. Dass unsere Wahrnehmungen und Perspektiven durch die sozialen Medien immer mehr auseinanderklaffen, ist ein immenses Problem. In früheren Jahrhunderten haben die Religionen und später die Ideologien die Filterblasen und Echokammern für verzerrte Realitätswahrnehmungen gebildet – mit den bekannten Folgen. Im Grunde erleben wir heute eine extreme Ausdifferenzierung dieser Strukturen. Und zum Schluss lebt jeder in seiner Blase.
Heißt das, Sie glauben, dass die sozialen Medien auch in den nächsten Jahrzehnten fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens bleiben werden?
Selbstverständlich. Kommunikationstechnologien haben sich tief in unseren Alltag eingegraben, sie verschwinden nicht einfach wieder. Allenfalls kann man spekulieren, dass sie durch eine nächste Technologiegeneration überholt werden, etwa wenn jeder Mensch (nach dem Motto „Ich bin viele.“) von einem Schwarm KI-Stellvertreter auch im Sozialen unterstützt wird, wir sozusagen von hyper-sozialen Medien umgeben werden.
Ganz ehrlich: Das klingt ausgesprochen gruselig!
Sie selbst scheinen soziale Medien aber gar nicht zu nutzen, oder? Zumindest haben wir nichts gefunden … Falls wir richtig liegen, darf man fragen, warum nicht?
Wahrscheinlich liegt der Hauptgrund darin, dass ich die Idee für erschreckend halte, ständig irgendetwas „teilen“ zu müssen. Also etwas, was ich selbst für einen wichtigen, sinnvollen und originellen Beitrag halte. Es würde mich zu viel Zeit und Mühe kosten, ständig mit etwas Neuem präsent zu sein. Einfach aus unserem Leben berichten? – Da schreibe ich lieber witzige Ansichtskarten.
Vielleicht würde ich mich anders verhalten, wenn ich die sozialen Medien als Marketinginstrument für unsere Bücher betrachten würde. Als reines Informationsmedium genügt unsere etwas altmodische und selten ganz aktuelle Website steinmuller.de. Fast hätte ich es vergessen: Auf LinkedIn habe ich 870 berufliche Kontakte. Auch diese nutze ich kaum.
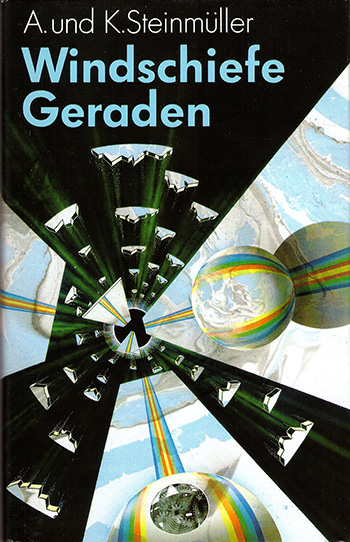
Sie haben sich mit Literatur über Atlantis beschäftigt. Was fasziniert Sie an dem Thema?
Bei Atlantis treffen sich Nostalgie, Utopie und Mythologie. Spannend ist, dass sich seit der frühen Neuzeit (Francis Bacon: „Nova Atlantis“, 1624; Athanasius Kircher: „Mundus Subterraneus“, 1664) offenbar jedes Zeitalter das Atlantis erträumt, das es braucht. Bei Jules Verne liegen leider nur ein paar antike Ruinen auf dem Meeresgrund herum; er hat (wie öfters) gekniffen. In den 1990ern haben wir, Angela und ich, außerdem Bekanntschaft mit Helga und Hans-Jürgen Müller gemacht, den Galeristen und Kunstvermittlern, die Atlantis neu erschaffen wollten. Für sie hat der Architekt Leon Krier ein wunderbares antikisierendes Ensemble entworfen. Ein bestrickender Traum von einem pseudo-antiken Ort der Weisheit und des Humanismus auf einer der kanarischen Inseln! Ersatzweise haben wir diesen Traum in unserer Erzählung „Auf schwankendem Boden“ (enthalten in „Marslandschaften“) verwirklicht. Aber es gilt nun einmal: Atlantis muss untergehen!
Sie finden Jules Verne fantasielos?
Nein, aber er hat gekniffen. Er wollte ja stets im Rahmen des technisch Vorstellbaren bleiben und dazu passt, dass er sich auch in anderen Feldern an den wissenschaftlichen Kenntnisstand seiner Zeit hielt. Daher finden wir bei ihm keine ausufernden Phantasien über Städte von Vorzeitzivilisationen auf dem Meeresgrund oder über Bauwerke der Mondbewohner oder wiedererweckte Vorzeitmonster. Er hat sich da engere Grenzen gesetzt als beispielsweise die Autoren von voyages imaginaires ein Jahrhundert vor ihm oder auch als Kurd Laßwitz.
Mit Alternativ-Geschichte(n) zur DDR haben Sie sich auch auseinandergesetzt. Was begeistert Sie an Gedankenexperimenten zu alternativen historischen Verläufen?
Historische Gedankenexperimente verbinden eine spielerische und eine analytische Komponente: Was wäre gewesen, wenn …? Man fragt nach den entscheidenden Weichenstellungen im Geschichtsverlauf, nach Einflussmöglichkeiten von Persönlichkeiten und sozialen Bewegungen, nach realen und rein fiktiven, eingebildeten Alternativen. Ganz ähnlich in der Zukunftsforschung bei der Konstruktion von Szenarien. Hier geht es ebenfalls um Entscheidungspunkte, um alternative Zukünfte, um Kausalitäten. Erstaunlicherweise nehmen Historiker und Zukunftsforscher nur ausnahmsweise voneinander Kenntnis. Auch manche alternativ-geschichtliche SF geht über das bloße Spiel mit möglichst bizarren historischen Versatzstücken hinaus. Solche Romane oder Essays zeigen verborgene Optionen, sie verändern auch den Blick auf die Gegenwart. Häufig werden Alternativgeschichten nicht von einem Erkenntnisinteresse, sondern vom Wunsch nach einem besseren Geschichtsverlauf getrieben: Es hätte doch auch anders kommen können …
Im – ebenfalls auf Ihrer Homepage abrufbaren – Text „Die DDR in der Alternativgeschichte“ sprechen Sie das Fehlen einer Sichtweise an: Es gibt kein Werk, das „eine lebenswerte sozialistischen Alternative in Betracht zieht“. Woran könnte es Ihrer Meinung nach liegen, dass dieser Gedanke nicht verarbeitet worden ist? Sehen Sie Möglichkeiten dass zumindest Teile des sozialistischen Systems in einem demokratischen System übernommen werden können? Und wenn ja, können Sie Bestandteile nennen, die zu adaptieren möglich und/oder sinnvoll wären und warum?
Ich hätte mir wirklich ein Werk mit einer lebenswerten sozialistischen Alternative gewünscht (aber etwas fasslicher als in Robert Havemanns „Morgen. Die Industriegesellschaft am Scheideweg“ von 1980). Offensichtlich findet die utopische Phantasie keine brauchbaren Ansatzpunkte beim „real existierenden“ DDR-Sozialismus. In der DDR-Gesellschaft gab es einige bewahrenswerte Aspekte, etwa Polykliniken, Betriebskindergärten oder Frauenförderung, aber nichts, was nützlich sein könnte, wenn man neue Modelle für demokratische Prozesse entwickeln will. Die Diktatur unterdrückte jedwede Partizipation von unten, da diese die Herrschaft der Partei hätte erschüttern können. Abgesehen davon hatte keiner der Autoren von Alternativgeschichten um die DDR die Absicht, eine Utopie zu schreiben. Eigentlich schade. Wo ist der Roman über den „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“, von dem die Akteure des Prager Frühlings 1968 träumten?

Im Hinblick auf die nationalistischen Tendenzen in Europa und dem Ausstieg Englands aus der Gemeinschaft: Wie schätzen Sie die Zukunft der EU ein?
Die letzte Szenario-Studie zur Zukunft Europas, an der ich selbst beteiligt war, wurde nun schon vor sieben Jahren durchgeführt. Das Spektrum der Möglichkeiten, das wir damals betrachteten – von mehr Integration bis zu zunehmender Desintegration –, war recht breit. Immerhin zogen wir schon den Brexit in Erwägung. Bei einem Blick aus weiter historischer Perspektive sehen wir, dass über die Jahrzehnte die EU enger zusammengewachsen ist, oft auch durch Krisen! Jetzt kann man fragen, wie sich die großen Herausforderungen (Klimawandel, Innovationswettlauf, Demographie usw.) und geopolitischen Veränderungen (zunehmend aggressive Rolle Chinas, Schwächung der USA, Konflikte in der Nachbarschaft) auf die EU auswirken. Unter welchen Bedingungen sind sie eher förderlich für eine weitere Integration? Wann erzeugen sie Spaltungseffekte? Wenn die Mitgliedsstaaten im Inneren den Zusammenhalt verlieren oder Populisten ans Ruder kommen, wird äußerer Druck eher zu einem Auseinanderdriften führen. Und die nächste Wild Card kommt mit Sicherheit.
Sehen Sie eine Diskrepanz zwischen dem technischen Fortschritt und dem kulturellen, sozialen, juristischen, politischen und ethischen? Wenn ja, als wie groß schätzen Sie diese Diskrepanz ein, wie kann sie ausgeglichen werden und sehen Sie Bemühungen dahingehend in der Gesellschaft und/oder bei Institutionen?
Die „cultural lag“-Theorie besagt, dass Gesellschaften (culture) den technologischen Entwicklungen immer hinterherhinken (lag) – und das vielleicht schon seit der Sattelzeit um 1800. Eine neue Technik wird erst dann gesetzlich reguliert, wenn sie sich bereits auf dem Markt etabliert hat. Die Technikfolgenabschätzung bemüht sich, dem zuvor zu kommen, sodass Innovationen rechtzeitig – in einem frühen Entwicklungszustand – gestaltet werden können. Bislang mit mäßigem Erfolg. Positiv interpretiert könnte man in dem Nachhinken eine Triebkraft gesellschaftlicher Entwicklungen sehen. Die Diskrepanz wird meines Erachtens erst dann verschwinden, wenn der technische Fortschritt zu einem Stillstand kommt. Man kann spekulieren, dass dies noch im gegenwärtigen Jahrhundert geschieht, wenn die Entwicklungspotentiale der Technologien einigermaßen ausgereizt sind. – Aber darauf würde ich nicht wetten.
Wir sind sehr von den fantasievollen, psychedelischen Covern und Illustrationen Ihrer Romane begeistert, die aber leider – wie etwa bei „Pulaster“ – nicht mehr für Neuauflagen übernommen worden sind. Sind Sie in der Gestaltung Ihrer Bücher auf irgendeine Weise involviert? Gibt es ein Covermotiv, das Ihnen am besten gefällt?
Die Illustrationen von Schulz und Labowski zu „Andymon“ und „Pulaster“ in der BASAR-Reihe würde ich nicht als psychedelisch bezeichnen, schon weil sie schwarz-weiß sind, und bei der Shayol-Ausgabe waren das einfach astronomische Motive. „Psychedelisch“ trifft eher auf die Arbeiten von Wolfgang Spuler zu, der den Erzählungsband „Windschiefe Geraden“ und den Roman „Der Traummeister“ ganz wundervoll und mit einer überwältigenden Liebe zum Detail illustriert hat. Es war ein Glücksfall, dass der Verlag Das Neue Berlin die Bücher so opulent mit eingehängten Farbtafeln ausstattete. Das Design unserer gesammelten Werke bei Memoranda finde ich ebenfalls absolut gelungen: zurückhaltend und gediegen. Und ich bin froh, dass wir mit Thomas Hofmann einen Grafiker haben, der die Titelvignetten wirklich überzeugend gestaltet. Er zeigt uns die Entwürfe, wir diskutieren darüber und bisweilen geben wir auch eine Anregung.
Können Sie etwas zur Gesamtausgabe Ihrer Werke bei Memoranda sagen? Ungewöhnlich ist, dass im September Band 10 erschienen ist, die Bände 1 und 6 allerdings noch kommen … wie kam es denn dazu?
Die Bände 1 und 6 sind bereits im Rahmen unserer gesammelten Werke im Shayol-Verlag erschienen. Hätte dieser Verlag nicht plötzlich die Arbeit eingestellt, wären wir vielleicht schon weiter. Aber wir sind ungeheuer froh, dass Hardy Kettlitz mit seinem Memoranda-Verlag die Reihe fortsetzt. Alle bisherigen Titel kommen mit dem neuen Design und z.T. auch ergänzt wieder heraus. Wichtiger waren für uns aber erst einmal die neuen Bände mit nur verstreut oder noch gar nicht publizierten Erzählungen. Jetzt wollen wir auch daran gehen, ausgewählte Essays in die Gesamtausgabe aufzunehmen.
Hat sich das Science-Fiction-Genre im Laufe der letzten Jahre verändert? Und wenn ja, wie? Wir haben leider nicht so einen Überblick über den literarischen Markt, was aber auffällig ist: Science Fiction ist in den Kinocharts regelmäßig und viel vertreten, aber überwiegend in Form von Superheldengeschichten, Remakes („Planet der Affen“ z.B.) oder Fortsetzungen („Star Wars“ z.B.) also alles Stoffe, die auf althergebrachte Motive rekurrieren. Wie sehen Sie die Entwicklung(en)?

Um diese Frage beantworten zu können, müsste ich einen Überblick über das Feld haben. Aufgefallen ist mir die immense Differenzierung, die enorme Spannweite von Military-SF bis Afrofuturismus, von Alternativgeschichte bis zu Thrillern, die in der nahen Zukunft spielen. Es gibt Nischen und innerhalb dieser weitere Nischen, Crossovers mit anderen Genres. Ich hätte nie gedacht, dass einmal Zeitreisen für romantische Liebesgeschichten missbraucht würden! Oder dass einmal so viele Romane im Präsens – dem Reportagen-Stil – geschrieben würden. Aber womöglich ist das für temporal schnell überforderte Leser-Zielgruppen wie Young Adults oder All Ager richtig. Ich vermute auch, dass nur ein kleiner Teil der interessanten internationalen SF zu uns gelangt. Kürzlich las ich etwa eine englischsprachige Anthologie faszinierender israelischer SF „Zion’s Fiction“, die hier leider keinen Verlag findet. Vielleicht tritt ja auch unsere Gesellschaft geistig ein wenig auf der Stelle, so dass kaum revolutionär neue Themen in der SF auftauchen?
In dem Zusammenhang: Welcher aktuelle Science-Fiction-Roman und welcher aktuelle Science-Fiction-Film der letzten 1-2 Jahre hat Sie überzeugt und wird von Ihnen empfohlen?
Mich beeindrucken die Erzählungen von Ted Chiang – auch der Film „Arrival“ (2016), nach einer Story Chiangs, hat mich gefesselt. Empfehlen möchte ich den Band „Der einheitliche Wille des gesamten Sowjetvolkes“ von Kir Bulytschow mit witzigen und spannenden Erzählungen, die zugleich viel über die spät-sowjetische Mentalität aussagen.



Kommentare