„Ich bin mehr ein Optimist.“
Im Gespräch mit Dennis E. Taylor, Autor von „Ich bin viele“
Der Kanadier Dennis E. Taylor arbeitete lange als Software-Programmierer. 2015 legte er mit dem Science-Thriller„Outland“ sein Romandebüt vor, das er damals noch in Eigenregie veröffentlichte. Der Durchbruch als Autor gelang ihm 2016 mit dem ungewöhnlichen SF-Roman „Ich bin viele“ (im Shop), dem ersten Band der „Bobiverse“-Serie. Im Buch hofft der reiche Software-Entwickler Bob Johansson, dem Tod mithilfe von Kryo-Technologie ein Schnippchen zu schlagen – und wacht im 22. Jahrhundert als Bewusstsein einer künstlichen Intelligenz auf, die sich einer dystopischen Erde gegenübersieht, Sonden ins All fliegt, fremde Planeten erforscht und KI-Klone mit verschiedenen Charakterausprägungen erschafft. „Ich bin viele“ wurde u. a. ins Deutsche, ins Französische, ins Ungarische und ins Tschechische übertragen und inzwischen mit zwei Romanen fortgesetzt. Im Interview spricht Dennis E. Taylor über die Gemeinsamkeiten zwischen dem Programmieren und dem Romanschreiben, das Interesse an faktenreicher Hard-Science-Fiction, Star Trek und die Gefahren von künstlicher Intelligenz.
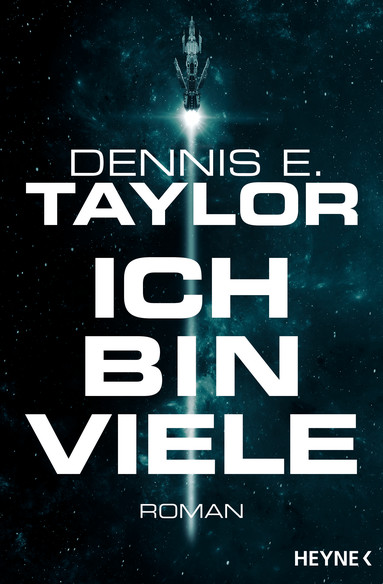 Hallo Mr. Taylor. Können Sie uns ein bisschen etwas über die Entstehungsgeschichte Ihres ersten Bob-Romans erzählen?
Hallo Mr. Taylor. Können Sie uns ein bisschen etwas über die Entstehungsgeschichte Ihres ersten Bob-Romans erzählen?
Als ich entschied, mich im Schreiben eines Romans zu versuchen, standen mir zwei Ideen zur Verfügung, die seit langer Zeit durch mein Gehirn filterten. Ich konnte mich nicht entscheiden, welche Idee ich zuerst ausprobieren sollte, weshalb ich im Grunde eine Münze geworfen habe. Der erste Roman wurde „Outland“, der zweite „Ich bin viele“. Letzterer ist lose von Larry Nivens „Wie die Zeit vergeht“ inspiriert, allerdings wollte ich in eine andere Richtung gehen und keinen von der Biologie eingeschränkten Protagonisten, weshalb ein hochgeladenes Bewusstsein der nächste offensichtliche Schritt war.
Larry Niven ist nicht unbedingt der erste Einfluss, an den man bei einem kanadischen SF-Autor denkt – da ist man dann doch eher bei Gibson (im Shop) und Atwood …
Möchte man meinen, was? Aber nein. Meine wichtigsten Einflüsse sind in unbestimmter Reihenfolge: Larry Niven (im Shop), Steven Gould, Robert J. Sawyer und Robert A. Heinlein (im Shop). Aber ich habe in meinem Leben viel Science-Fiction gelesen und etwas von allem aufgenommen.
Wussten Sie von Anfang an, dass „Ich bin viele“ ein so ungewöhnlicher, vielseitiger Mix aus Cyberpunk, Dystopie und Space Opera werden würde?
Nicht wirklich. Die ursprüngliche Idee hätte schon für einen einzelnen Roman ausgereicht, doch als ich mit der Outline begann und einige der Handlungsstränge hinzufügte, wuchs und wuchs das Buch einfach immer weiter. Letztlich haben es verschiedene Supblots schlichtweg deshalb nicht in die finale Trilogie geschafft, weil es sonst in zu viele Richtungen gegangen wäre.
„Star Trek“ (im Shop) ist ein wichtiger Bezugspunkt im Roman. Sind Sie ein Fan?
Ich bin nicht fannish im übliche Sinne – ich jage keine Autogramme und mache kein Cosplay. Ich war bisher auch noch auf keiner Convention. Doch ich bin definitiv ein „Star Trek“-Fan. Ich glaube, dass ich am meisten den Grad an Optimismus mag, den Roddenberry in das Franchise installiert hat.

Ihre eigene optimistische Betrachtung von künstlicher Intelligenz ist erfrischend – das genaue Gegenteil von Skynet. Denken Sie, KI wird die Welt zu einem besseren Ort machen?
Nicht zwangsläufig, nein. Ich bin tendenziell mehr ein Optimist, weshalb meine Romane wahrscheinlich dazu neigen, eher optimistisch als pessimistisch zu sein. Aber welchen Weg wir mit KI einschlagen, hängt im Augenblick von zu vielen Unbekannten ab. Mit künstlicher Intelligenz ist es wie mit modernen Waffen. Sie können für uns eine Gefahr sein, aber auch dazu verwendet werden, uns zu beschützen. Wie mit allem ist es ein Wettrüsten. Ich habe ein paar Ideen für künftige Romane, die womöglich nicht ganz so optimistisch sein werden.
Hat Ihr früherer Job als Programmierer Einfluss auf Ihre Arbeit als Romancier?
Der Prozess des Verfassens eines Romans erzeugt bei mir dasselbe Gefühl wie das Schreiben eines Programms. In beiden Fällen geht es darum, eine Struktur aufzubauen und zu verfeinern, Features hinzuzufügen, Bugs zu entfernen und ein fertiges Produkt zu erschaffen.
Würden Sie sagen, als Programmierer steht man eher auf Hard-SF, also Science-Fiction mit harten wissenschaftlichen Fakten?
Ich bin mir sogar sicher, dass es derselbe Persönlichkeitstyp ist, der sich zu beidem hingezogen fühlt. Ich würde darauf wetten, dass das Mengendiagramm beider Domänen sich beinahe vollständig überlappt.
 Wann wissen Sie als Autor, dass zu viel Fachwissen in Ihrem Text steckt? Und hat der Erfolg von Andy Weirs „Der Marsianer“ (im Shop) mit seinem launigen Ton und seinen vielen Fakten die Regeln für die Mainstreamtauglichkeit der Hard-SF verändert?
Wann wissen Sie als Autor, dass zu viel Fachwissen in Ihrem Text steckt? Und hat der Erfolg von Andy Weirs „Der Marsianer“ (im Shop) mit seinem launigen Ton und seinen vielen Fakten die Regeln für die Mainstreamtauglichkeit der Hard-SF verändert?
Wir reden hier über Info-Dumping und Exposition. Meines Erachtens variiert die Toleranz der Leserschaft demgegenüber von Genre zu Genre. In der Science-Fiction und der Fantasy herrscht eine hohe Toleranz vor, existiert tatsächlich sogar ein Verlangen danach. Schließlich gehört es zu den Hauptmerkmalen von sowohl SF als auch Fantasy, dass wir in Welten eingeführt werden, bei denen es sich nicht um unsere handelt. Ein Teil der Faszination für das fantastische Genre besteht darin, herauszufinden, was Autoren getan haben, um eine andere Welt zu erschaffen, und wie gut sie es gemacht haben. Doch selbst in der Science-Fiction gibt es Spielraum.
„Der Marsianer“ schildert sehr detailliert, wie Watney überlebt – zu detailliert für manche Leute. Aber es gibt genug SF-Fans, die genau diesen Detailreichtum lieben und denken, dass er der Geschichte Glaubwürdigkeit verleiht, was „Der Marsianer“ zum Goldstandard der erfolgreichen Hard-SF machte. Ich denke dennoch nicht, dass es die Regeln verändert hat. In meinen Augen warf es viel mehr ein Licht auf die Tatsache, dass es da draußen viele Leser gibt, die nach dieser Sorte Geschichten hungern. Und hoffentlich reagieren Autoren und Verlage mit mehr darauf.
Was die Frage danach angeht, wie viel Hard-SF zu viel Hard SF ist: Die Meinung des Lektors ist wichtig, genauso die kritischer Partner und Betaleser. Aufgrund des Feedbacks dieser Menschen glaube ich, einige Techniken entwickelt zu haben, um die Balance richtig hinzukriegen.
Beim Lesen von „Ich bin viele“ dachte ich mir oft: Cooler Stoff – aber eigentlich unmöglich zu verfilmen. Kam Ihnen das beim Schreiben je in den Sinn angesichts der täglichen Ankündigungen zu neuen SF-Projekten in Film und Fernsehen?
Ich würde es nicht als unmöglich bezeichnen. Die Sequenzen in der virtuellen Realität wären der Schwerpunkt des Films oder der Serie, einfach ein geeigneter Ort für die Bobs zum Reden. Ein Großteil des echten Konflikts findet in der realen Welt statt, also müsste man einfach nur früh festlegen, dass Bobs Perspektive strikt virtuell ist, und alles andere wäre die handelsübliche Space Opera.
Apropos Perspektive. Welche Version von Bob und seinen Klonen ist Ihnen am ähnlichsten?
Ich wäre Bill, gar keine Frage.
Zum Schluss darf diese Frage nicht fehlen: Würden Sie Ihren Kopf mit Kryo-Technik für eine Wiederbelebung in der Zukunft einfrieren lassen?
Oh hell yes. Meldet mich schon mal an!
Autorenfoto: Privat
Dennis E. Taylor: Ich bin viele • Aus dem Amerikanischen von Urban Hofstetter • Wilhelm Heyne Verlag, München 2018 • Paperback • 464 Seiten • € 14,99 • im Shop • ein erster Ausblick auf „Ich bin viele“



Kommentare